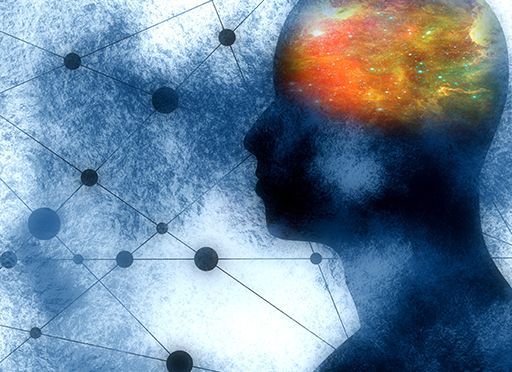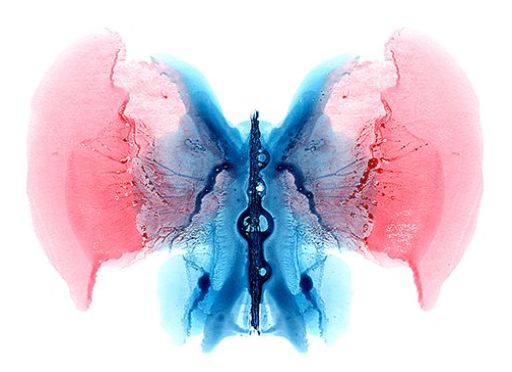„Unsere Selbsteinschätzung ist völlig verfälscht, weil wir uns zu sehr auf unsere Defizite konzentrieren.“

Frau Muthig, mit Ihrem Buch Und morgen fliege ich auf wollen Sie Menschen helfen, die unter dem sogenannten Impostor-Syndrom leiden. Könnten Sie kurz erläutern, was man darunter versteht bzw. wie sich das bei Betroffenen äußert?
Dieses Phänomen ist gar nicht mal selten, sondern betrifft viele Menschen. Es handelt sich dabei um die feste Überzeugung, nicht gut genug zu sein. Und das, obwohl man in seinem Bereich oft sehr erfolgreich ist. Zu den Betroffenen zählen beispielsweise Uniprofessoren, Topspeaker oder auch Oscargewinner. All die Erfolge, Preise und Fans reichen aber nicht aus, damit sich diese Leute selbst davon überzeugen können, gut zu sein. Stattdessen fühlen sich die Betroffenen wie Hochstapler. Sie denken, sie hätten den Erfolg und die Auszeichnungen gar nicht verdient – und dass man irgendwann merken wird, dass sie es eigentlich gar nicht draufhaben. Dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein, hat dem Phänomen seinen Namen gegeben.
Die meisten Menschen haben wohl hin und wieder mal Zweifel an sich selbst. Woran erkenne ich denn, dass das, was ich empfinde, eher auf das Impostor-Syndrom hindeutet als auf gesunde Selbstkritik?
Bei normalen Selbstzweifeln führen Erfolge dazu, dass die entsprechenden Personen mit der Zeit Selbstvertrauen entwickeln und die Selbstzweifel weniger werden. Sie lernen also, dass sie die Anforderungen erfüllen können. Beim Impostor-Syndrom ist es hingegen so, dass die Erfolge die Selbstzweifel nur noch verstärken.
Die Betroffenen haben das Gefühl, dass die Erwartungen an sie durch die zunehmenden Erfolge steigen. Gleichzeitig lernen sie aus ihren Erfolgen nicht, dass sie gut genug sind, sondern führen ihre Erfolge eher auf Glück oder andere Ursachen zurück. Umso mehr stehen sie dann unter Druck, und die Versagensängste wachsen.
Michaela Muthig
Was kann ich tun, wenn ich bemerke, dass ich dazu tendiere, mich selbst schlechtzumachen?
Auf jeden Fall sollten Sie sich über das Impostor-Syndrom informieren. Zu wissen, dass es häufig vorkommt und wie es sich äußert, ist schon mal der erste Schritt. Auch hilft es, dann darüber zu reden. Daneben gibt es noch weitere Dinge, die man tun kann, beispielsweise ein Erfolgstagebuch führen, positives Feedback bewusst sammeln – und vor allem: es auch annehmen.
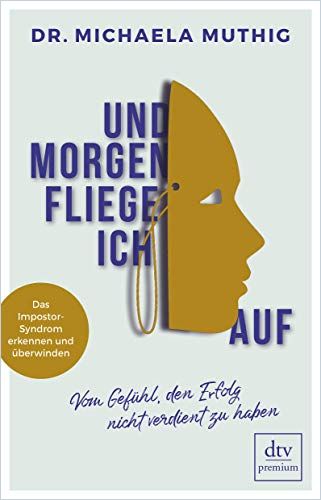
Uns mit anderen zu vergleichen bzw. Kritik ernst zu nehmen, bewahrt uns aber auch vor einem überzogenen Selbstbild. Wie viel Erfolg darf man sich zugestehen, ohne dass die realistische Selbsteinschätzung leidet?
Da haben Sie Recht: Vergleiche mit anderen, sich Kritik zu Herzen nehmen und sogar eine gewisse Portion Selbstzweifel sind gut, weil wir uns dadurch weiterentwickeln und besser werden. Aber auch hier macht meist die Dosis das Gift. Wir haben oft das Gefühl, wir würden unsere realistische Selbsteinschätzung verlieren, uns also etwas vormachen, wenn wir uns über Lob freuen. Aber in Wirklichkeit ist unsere Selbsteinschätzung – nicht nur beim Impostor-Syndrom, aber da ganz extrem – doch sowieso schon völlig verfälscht und nicht „realistisch“. Denn wir fokussieren uns oft zu sehr auf unsere Defizite: Wenn von zehn Rückmeldungen eine negativ ist und neun positiv sind, konzentrieren wir uns nur auf die negative und vergessen die positiven. Das ist dann eben kein realistisches Selbstbild mehr. Dies sollten wir uns bewusst machen und gegensteuern: nicht nur das Negative, sondern auch das Positive wahrnehmen und würdigen. Eine gute Möglichkeit, die Situation realistisch einzuschätzen, ist es, sich zu fragen „Würde ich das, was ich an mir so einschätze, bei einem anderen auch so sehen?“ So können wir oft erkennen, dass wir andere deutlich positiver bewerten als uns selbst.
Mittlerweile wird generell mehr über mentale Gesundheit gesprochen. Denken Sie, dass dies eine gute Entwicklung ist? Oder laufen wir vielleicht Gefahr, uns zu schnell selbst falsch zu diagnostizieren bzw. der Selbstwahrnehmung zu schnell einen „medizinischen“ Stempel aufzudrücken?
Ich finde die Entwicklung gut. Sie sorgt dafür, dass Leute aufgeklärt werden, und die Diskussion darüber rückt das Thema mehr in den Fokus, heraus aus der „Schmuddelecke“. Viel zu oft habe ich Menschen in der Psychosomatik behandelt, die sich für ihre Depression beispielsweise geschämt hatten.
Ich wünsche mir definitiv nicht die Zeit zurück, als alle psychischen Probleme entweder totgeschwiegen oder lapidar als ‚Der hat sie doch nicht alle‘ abgewertet wurden.
Michaela Muthig
Aber auch hier ist maßgeblich, wie genau wir damit umgehen.
Das bedeutet …?
Wir sollten, wenn wir bei uns Phänomene oder Symptome wiedererkennen, das nicht nutzen, um uns selbst abzuwerten – „Ich bin einfach voll gestört.“ –, andere vorschnell in eine Schublade zu stecken – „Der ist doch ein Narzisst!“ – oder es als Ausrede zu nutzen, nichts verändern zu müssen – „Ihr müsst alle auf mich Rücksicht nehmen, ich bin halt einfach hochsensibel.“. Es geht hier nicht darum, Verantwortung abzuschieben, sondern sie für uns selbst immer neu zu übernehmen und zu überlegen, wer uns jetzt zur Seite stehen kann, damit wir – noch – besser für uns sorgen können.
Gerade die Coronakrise hat vielen Unternehmen gezeigt, dass das mentale Wohlbefinden von Mitarbeitenden einen großen Einfluss etwa auf die Produktivität hat. Könnte sich auch das Impostor-Syndrom im Speziellen negativ auf die Produktivität eines Mitarbeiters auswirken? Und wenn ja, inwiefern?
Oh ja, durchaus! Wenn jemand sehr starke Selbstzweifel hat, so versucht er entweder, sie durch Mehrarbeit zu kompensieren, oder er wird innerlich komplett blockiert. Das Ergebnis ist, dass jemand entweder, im Fall einer Blockade, eine Arbeit so lange aufschiebt, bis es wirklich kaum mehr geht, und dann noch schnell last minute ein halbwegs brauchbares Ergebnis erzielt. Oder im Fall der Überkompensation sich viel zu lange mit der Tätigkeit beschäftigt, weil er jeden Fehler vermeiden möchte. Das trifft insbesondere auf diejenigen zu, die perfektionistisch sind. Sie werden unproduktiv, weil sie viel zu lange brauchen. In beiden Fällen bleiben die Mitarbeiter unter ihren Möglichkeiten. Durch den Leidensdruck, der immer mehr steigt, kann es zudem sein, dass sie krank werden und längere Zeit ganz ausfallen – oder kündigen, weil sie den Druck nicht mehr aushalten.
Ist es Außenstehenden, etwa dem Vorgesetzten, möglich, zu erkennen, ob die Schwierigkeiten, die ein Mitarbeiter hat, vielleicht auf das Impostor-Syndrom zurückzuführen sind?
Nicht immer. Ich habe Menschen mit Impostor-Syndrom kennengelernt, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Auffallen würde uns natürlich, wenn die Selbsteinschätzung des Betroffenen völlig anders ist als die Einschätzung, die wir Außenstehenden von ihm haben. Aber nur selten sprechen die Betroffenen über ihre Selbstzweifel. Als Chef würde ich vermutlich hellhörig werden, wenn ich sehe, dass ein Mitarbeiter sehr kompetent ist, aber ständig unter Druck zu stehen scheint, lange im Büro bleibt, zunehmend belastet wirkt, ohne dass das mit der aktuellen Auftragslage erklärbar wäre.
Sie erwähnen in Ihrem Buch fünf verschiedene Ausprägungen des Impostor-Syndroms, die sich darin unterscheiden, dass sie die – ihnen Ihrer Ansicht nach fehlende – Kompetenz jeweils anders definieren. Äußern sich die Symptome dann auch unterschiedlich? Fällt also ein „Perfektionist“, der Kompetenz durch Makellosigkeit definiert, anders auf als ein „Einzelgänger“, der den Anspruch hat, alle Dinge allein schaffen zu müssen?
Eine gute Frage.
Auffällig ist etwa, dass, wenn wir jemanden zu einem Erfolg beglückwünschen, er oder sie abwiegelt. Das ist nicht immer falsche Bescheidenheit oder Fishing for Compliments, sondern kann ein Hinweis auf das Impostor-Syndrom sein.
Michaela Muthig
Wie das genau passiert, ob er das etwa mit „Ach, ich hatte doch ein ganzes Team hinter mir, allein hätte ich das nicht geschafft“ tut oder sie mit „Ach, so gut war das doch gar nicht. Schließlich habe ich ja am Anfang gleich mehrere Fehler gemacht“, lässt dann Rückschlüsse auf den Subtyp zu.
Wenn man als Außenstehender nun das Gefühl hat, eine Person leide unter einer Ausprägung des Impostor-Syndroms, wie soll man da reagieren? Gibt es einen Weg, Betroffenen aufzuzeigen, dass sie sich eben nicht objektiv, sondern durch den von Ihnen erwähnten Zerrspiegel betrachten?
Ich finde, dass ein gutes Vertrauensverhältnis das A und O dabei ist. Ich würde nicht sofort sagen: „Mit dir stimmt was nicht“. Damit schlagen wir die Betroffenen eher in die Luft – denn genau das ist ja ihre Befürchtung. Stattdessen sollte ich der Person eher erklären, warum ich sie bewundere, wie sie von außen auf mich wirkt, warum ich denke, dass sie stolz auf sich und ihre Leistung sein darf. Mit der Zeit und mit zunehmendem Vertrauen kann der Betroffene sich dann vielleicht auch anvertrauen und zugeben, dass er das gar nicht so sieht und an sich zweifelt. In dem Fall kann man dann ansprechen, dass es ein häufiges Phänomen gibt, bei dem die Betroffenen die eigenen Erfolge nicht wahrnehmen und sich für Hochstapler halten – und dass es sich lohnen könnte, mal zu schauen, ob er oder sie sich darin wiederfindet.
Ganz generell: Ist es überhaupt sinnvoll, sich da „einzumischen“?
Das kommt darauf an, wie nah mir derjenige steht, wie intensiv unser Verhältnis ist und ob er selbst von sich aus Hilfe zu suchen scheint oder um Rat fragt. Bei jemandem, mit dem ich nur zweimal im Jahr zu tun habe, würde dieser es eher als negatives Einmischen sehen. Bei einer guten Freundin, mit der ich viel Kontakt habe, ist es schon eher möglich, dies anzusprechen. Aber auf jeden Fall sollte vorher ein gutes Vertrauensverhältnis bestehen.
Einer Ihrer Tipps ist, Gegenbeweise zur eigenen Einschätzung mangelnder Kompetenz zu sammeln, indem man sich auf positive Rückmeldungen von außen beruft. Ist es nicht auch heikel, sein Kompetenzempfinden auf den Äußerungen anderer zu basieren? Was wäre mit Personen, die keine sehr guten Feedbackgeber in ihrem Umfeld haben – könnte das das Problem nicht verstärken?
Diese Gefahr besteht nur dann, wenn man sich ausschließlich auf die Anerkennung von außen konzentriert, sich also sozusagen davon abhängig macht. Das ist fatal. Aber das Feedback von außen kann durchaus helfen, sich deutlich zu machen, dass man mit seinem Selbstbild vielleicht falschliegt. Das Sammeln von positiven Rückmeldungen ist also eher ein Anstoß, aufmerksam zu werden und zu realisieren, dass was mit der eigenen Selbsteinschätzung falschläuft. Natürlich sollte man nicht beim Sammeln der positiven Rückmeldungen von außen stehen bleiben, sondern dadurch lernen, die eigenen Stärken und Erfolge besser zu erkennen, sich also selbst zu loben, um nicht mehr vom Feedback anderer abhängig zu sein.
Sie schreiben, dass das Bedürfnis, anderen zu gefallen oder deren Erwartungen an uns gerecht zu werden, ein Kernproblem beim Impostor-Syndrom ist. Sie erklären aber auch, dass dieses Bedürfnis tief in uns angelegt ist, weil es überlebenswichtig war. Hat das Bedürfnis, anderen gefallen zu wollen, nicht auch nach wie vor seine Berechtigung, weil wir nun mal auf andere angewiesen sind?
Ja, es hat seine Berechtigung, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher gerechtfertigt war. Als Kind waren wir massiv von den Erwachsenen abhängig. Nicht nur was existenzielle Themen wie Sicherheit, Ernährung oder Zuhause angeht, sondern auch hinsichtlich unseres Selbstwerts. Wir waren als ganz kleines Kind darauf angewiesen, was andere uns erzählt haben, darüber, wer wir sind und ob wir gut sind. Mit zunehmendem Alter haben wir aber viel mehr Erfahrung, Kompetenzen und Möglichkeiten gewonnen. Wir wissen nun selbst, wie die Welt funktioniert und können selbst urteilen. Wir sind nicht automatisch in unserer Existenz bedroht, wenn uns jemand nicht mag. Das sollten wir uns bewusst machen: dass in unserer Angst davor eigentlich kindliche Ängste am Werke sind. In dieser kindlichen Angst überschätzen wir auch oft die Auswirkungen: Jemanden einmal verärgert zu haben, bedeutet nicht gleich, dass dieser den Kontakt zu uns dauerhaft abbricht oder uns anderweitig das Leben schwer machen wird.
Solche Gefühle und Sorgen sind Relikte aus der Kindheit. Wenn wir uns das bewusst machen, können wir realistischer einschätzen, wo wir Grenzen setzen und an welcher Stelle wir uns anpassen sollten, welche Erwartungen gerechtfertigt sind und welche überhaupt nicht.
Michaela Muthig
Auch hier hilft die Frage „Würde ich das von einem anderen auch so erwarten? Wie würde ich reagieren, wenn die Rollen vertauscht wären?“ Dieser Perspektivwechsel hilft, eine Situation angemessener einzuschätzen.
Über die Autorin
Michaela Muthig ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Als Coachin begleitet sie Menschen, die vom Impostor-Syndrom betroffen sind.