Ableismus – die akzeptable Form von Diskriminierung?

Vor einiger Zeit berichtete eine Frau auf „X“ bzw. Twitter über einen rassistischen Übergriff, den sie beobachtet hatte, und beschrieb ihr Entsetzen darüber, wie völlig unfähig sie gewesen sei, in diesem Augenblick angemessen zu reagieren. Viel erschreckender als diese nachvollziehbare Reaktion – an der sich arbeiten lässt – war für mich der Vergleich, den sie wählte: Es sei so gewesen wie damals, als die Familie nach einem medizinischen Notfall gedacht hätte, ein Angehöriger bliebe „Pudding“.
Während viele Menschen einen Like hinterließen oder Verständnis und Mitgefühl für beide Situationen ausdrückten, blieb eine Reaktion weitestgehend aus: der Hinweis darauf, dass eine solche Äußerung ebenso menschenverachtend ist wie der Vorfall, den sie zuvor schilderte.
Das Bewusstsein für (eigenes) Verhalten, das Menschen stigmatisiert und ausgrenzt, ist in Bezug auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Menschen mit Behinderungen gehören zu denjenigen, die (unbewussten) Vorurteilen besonders stark ausgesetzt sind.
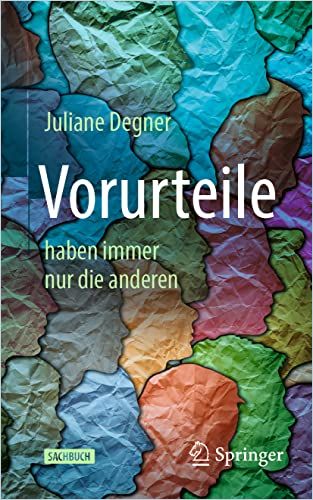
Wo liegen die Ursachen?
Obwohl in Deutschland rund 7,8 Millionen Personen mit einer Schwerbehinderung leben – mit einer Einschränkung ihrer körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit –, sind behinderte Menschen in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens (fast) unsichtbar: Spielplätze und Sportstätten bieten für sie meistens keine Angebote. Die Inklusion in Schulen verläuft zögerlich. Ihre Arbeitslosenquote ist hoch, oder die Menschen sind in Werkstätten beschäftigt – ohne Mindestlohn, dafür außerhalb des Blicks der Öffentlichkeit. Dazu kommen zahlreiche Barrieren im Alltag, die die gesellschaftliche Teilhabe erschweren bzw. verunmöglichen.
Die mangelnde Sichtbarkeit trägt maßgeblich dazu bei, dass wir wenig über sie wissen und sich stereotypische Zuschreibungen hartnäckig halten.
Bei unserer „Ingroup“, bei Menschen also, die uns tagtäglich umgeben und denen wir uns verbunden fühlen, nehmen wir neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede sehr deutlich wahr. Bei Menschen, die uns fremd sind – der Outgroup – ist das anders. Da wirkt der „Outgroup-Homogenitätseffekt“: Wir sehen (fast) ausschließlich das übergreifende Ordnungsmerkmal, nach dem wir sie sortieren, und ignorieren die Individualität ihrer Mitglieder.

Dazu kommen bei behinderten Menschen noch paternalistische Vorurteile, die ihnen Kompetenz und Qualifikation absprechen. Im Endeffekt führt das dazu, dass beim Gedanken an eine Behinderung vor unserem inneren Auge tendenziell das Bild einer (hilfsbedürftigen) Person im Rollstuhl entsteht. Die dadurch oft ausgelöste, ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung nennt man „Ableismus“.
Und jetzt?
Wir alle sind vielleicht doch nicht so vorurteilsfrei, fair, offen, gerecht und „aufgeklärt“, wie wir es gerne wären. Dass wir das aber nicht wahrnehmen, liegt am „Bias Blind Spot“. Wir sind gut darin, Fehler bei anderen zu erkennen – die eigenen bemerken wir dafür eher selten.

Zudem sind die allermeisten Menschen überzeugt, selbst weniger voreingenommen zu sein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Daher sehen wir auch keinen Grund, eigenes Verhalten zu hinterfragen. Stattdessen stellen wir selig und selbstzufrieden unsere (angeblich) überragenden moralischen Werte zur Schau und weisen jegliche Kritik als unbegründet zurück.
Was lässt sich tun, um das zu verändern?
Dass wir gut darin sind, Fehler bei anderen zu entdecken, ist der perfekte Ausgangspunkt, um (wertschätzendes) Feedback zu geben. Die Kunst ist es, dieses anzunehmen. Das ist schwierig, besonders wenn es um die eigene Haltung zu sozialen oder gesellschaftlichen Themen geht. Diese Aspekte sind oft so zentral für unsere Selbstwahrnehmung, dass eine entsprechende Rückmeldung die eigene Identität gefährden kann. Dann agieren wir von der Annahme aus, dass wir kompetent oder inkompetent, gut oder böse, liebenswert oder nicht sind. Dazwischen gibt es nichts. Entsprechend ist es unser Ziel, unser Alles-oder-nichts-Selbstwertgefühl zu schützen.
Erst wenn wir Grautöne akzeptieren und ein differenzierteres Selbstbild aufbauen, können wir Kritik annehmen und auf dieser Basis lernen.
Um uns – quasi im stillen Kämmerlein – mit Fragen zu Werten und unbewussten Denkmustern auseinanderzusetzen, ist der IAT, der „Implicit Association Test“ ein hilfreiches Instrument. Er misst Einstellungen und Glaubenssätze, derer wir uns eventuell gar nicht bewusst sind. Weil Stereotype oder gesellschaftliche Konventionen unser Denken beeinflussen, stimmen unsere Überzeugungen und automatischen Assoziationen längst nicht immer überein.

Der IAT kann daher helfen, blinde Flecke in unserem Denken zu identifizieren und zu adressieren und damit auch behinderten Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
Nächste Schritte:
Weitere praktische Tipps und Tricks bietet Fair führen. Das Buch wurde mit dem getAbstract International Book Award 2020 ausgezeichnet. Laut Jury liefert es „nicht weniger als das erforderliche Rüstzeug für zukunftsfähige Unternehmen – eloquent, sachkundig und inspirierend.“





