„Managementbücher sind das naive Versprechen: Ein Paradies auf Erden ist möglich.“

Herr Kühl, Sie haben für Ihr Buch Schattenorganisation ausgiebig zu holakratischen Organisationen geforscht. Würden Sie gern in einer solchen arbeiten?
Stefan Kühl: Ja, vom Interesse her auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, dass mir als Praktiker gerade in kleineren holakratischen Organisationen das Übermaß an Bürokratisierung auf die Nerven gehen würde. Durch meine Beratungstätigkeit für große Unternehmen und meine Arbeit an der Universität bin ich oft mit Bürokratisierungstendenzen konfrontiert. Da frage ich mich schon, warum man in einem eigentlich sehr dynamischen Unternehmen mit 20 bis 40 Personen den gleichen Grad an Formalisierung braucht wie in einem Großkonzern mit Tausenden von Mitarbeitenden.
Sind diese Organisationen also am Ende weniger agil, als sie vorgeben?
Nun, wir wissen aus der Forschung, dass kleinere Unternehmen wie Start-ups am Anfang oft sehr flexibel sind und sich durch eine sehr enge persönliche Nähe auszeichnen. Gleichzeitig entstehen dadurch natürlich auch Kosten wie ungelöste Kompetenz- und Machtkonflikte. Holakratische Organisationen versuchen – wohlwollend formuliert – die problematischen Effekte von Mikroorganisationen abzufedern, indem sie eine Form der Hyperformalisierung anstreben. Letztlich kopieren sie den Formalisierungsgrad von Großorganisationen im Kleinen und vermeiden so stark personifizierte Konflikte, die in lautes Rumschreien auf irgendwelchen Sitzungen ausarten.
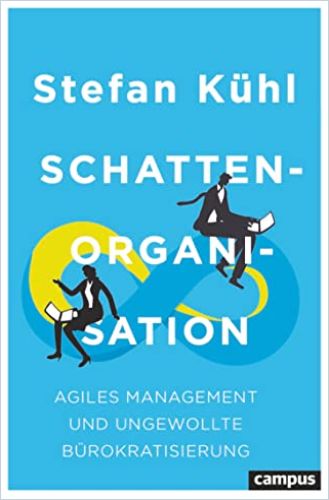
Wie muss man sich das vorstellen – Machtgefälle werden quasi wegformalisiert?
Ja, die holakratische Verfassung soll helfen, Hierarchien und Silos zwar nicht ganz abzuschaffen, aber zumindest stark zu schwächen. Abteilungen werden durch Zirkel ersetzt, Mitarbeitende berichten nicht mehr an Vorgesetzte, sondern an sogenannte Link-Leads und können gleichzeitig in verschiedenen Zirkeln unterwegs sein. In ihrer formalen Struktur richten sich diese Organisationen also völlig neu aus.
Die Verfechter von Holacracy wollen damit verhindern, dass Menschen in alte hierarchische Strukturen zurückfallen.
Und das funktioniert?
Das kommt darauf an, wen man fragt. Die Hardcore-Verfechter, die ich als holakratische Evangelikale bezeichnen würde, sind natürlich schwer angetan von dem Konzept und betrachten es auch als Erfolg. Bei den Mitarbeitenden sind die Rückmeldungen gemischt differenziert. Sie erwähnen zum Beispiel Formalitätsruinen, die entstehen, wenn sich niemand mehr so richtig an die holakratischen Regeln hält. Oder dass der Grund für die Einführung darin bestand, dass die Vorgesetzten, die 100 Prozent des Kapitals halten, einfach keinen Bock darauf hatten, zu führen und Orientierung zu bieten. Von außen betrachtet ist allerdings schon auffällig, wie viele Organisationen die Holakratie wieder abgeschafft haben.
Im Buch sprechen Sie von einigen Hundert Unternehmen weltweit, die das Konzept ausprobiert haben.
Ja, mehr sind es nicht. Ich würde sagen mit abnehmender Tendenz. Als Wissenschaftler muss ich mich rechtfertigen, dass ich mich überhaupt mit Holacracy beschäftige, weil es schon ein Minderheitenthema ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich interessant, weil es erstens eine von vielen Möglichkeiten ist, Agilität umzusetzen. Und zweitens kann man dabei unheimlich viel über Organisationen als Ganzes lernen. Man kann wie unter einem Brennglas sehen, wie Unternehmen funktionieren, die auf Formalität setzen, indem sie ihre Regeln verschriftlichen. Das macht sie zu einem spannenden Untersuchungsgegenstand für uns Soziologen.
Leider führt Holacracy, wie Sie festgestellt haben, oft nicht zum Abbau von Hierarchien und Silodenken. Im Gegenteil – es bilden sich Schattenstrukturen. Warum ist das so?
Wir kennen dieses Phänomen aus stark hierarchisch geprägten Organisationen: Die Mitarbeitenden sprechen sich untereinander ab und es entsteht eine informelle Gegenbewegung. Genau das haben wir in den von uns untersuchten holakratischen Organisationen beobachtet. Einer stark aufgeweichten formalen Hierarchie stand eine starke informelle Hierarchie gegenüber und es bildeten sich Silos, die so nicht vorgesehen waren – etwa wenn einzelne Mitglieder 98 Prozent ihrer Zeit in einem einzigen Kreis verbrachten und damit faktisch wieder Abteilungen bildeten. Das ist eine Art Schutzreflex, für den es verschiedene Gründe gibt. Zum Beispiel stellt sich in einer holakratischen Organisation irgendwann die Frage, was mit den Leuten passiert, die nicht die erwartete Leistung bringen. In einer diffusen Struktur gibt es dafür eigentlich keine Verantwortlichkeiten. Das heißt, es sind oft die Manager aus der alten Struktur, die entscheiden, ob Leute entlassen werden. Das Problem dabei ist, dass nach außen viel von Transparenz gesprochen wird, in der Schattenstruktur aber intransparente Strukturen herrschen.
Wenn es in der Natur des Menschen liegt, Hierarchien zu bilden, warum erfinden wir dann immer neue Managementmethoden, um diese abzuschaffen?
Ich glaube nicht, dass es in der Natur des Menschen liegt. Vielmehr gibt es bestimmte Notwendigkeiten.
Wenn man in Organisationen etwas durchsetzen will, muss man Macht einsetzen – und Hierarchie ist letztlich eine verfestigte Form von Macht. Das ist nicht überraschend. Es wäre eher überraschend, wenn man sagen würde: ,Machtkämpfe gibt es bei uns nicht.‘
Aber das Thema spielt im Managementdiskurs eine so große Rolle, weil man nicht aufhört zu träumen. Es ist wie mit der Religion: Wenn das Leben auf Erden trostlos ist, träumt man vom Paradies. Managementbücher sind letztlich nichts anderes als das naive Versprechen: Ein Paradies auf Erden ist möglich.
Das sind Sätze, bei denen Praktiker oft „Schnappatmung“ bekommen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Warum reagieren sie Ihrer Meinung nach so empfindlich?
Zunächst einmal: Ich mache ihnen daraus gar keinen Vorwurf, sondern finde es nachvollziehbar. Schließlich geht es bei der Positionierung mit einem Managementkonzept auch um wirtschaftliche Interessen. Es geht ganz konkret um Beratungsaufträge, was an sich kein Problem ist. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und eine Managementmethode ist ein Produkt, das auf den Markt gebracht wird. Wenn man dieses Produkt dann aus organisationssoziologischer Sicht zerlegt und auf positive Effekte, aber auch auf unerwünschte Nebenfolgen hinweist, dann ist das natürlich eine störende Information für diejenigen, die von diesen Konzepten überzeugt sind.
Über holakratische Organisationen schreiben Sie, es sei leichter, mit „staatlichen Geheimdiensten, militärischen Spezialkräften und kriminellen Rockerclubs“ in Kontakt zu kommen. Warum scheuen Holakraten die Öffentlichkeit?
Ich muss gestehen, dass mich das selbst überrascht hat, zumal diese Organisationen ständig Transparenz predigen und sich auch gerne in den Massenmedien präsentieren. Als Forscher dachte ich, dass wir sehr leicht an sie herankämen. Als ich dann bei einem dieser holakratischen Vorzeigeunternehmen für eine Vorrecherche vorbeischauen wollte, sagte man mir ein paar Wochen vorher ab. Zwei Mitarbeiter erklärten mir später den Grund: Offenbar gab es so starke mikropolitische Auseinandersetzungen um dieses Konzept, dass man meinte, ein Blick von außen würde diese nur noch verschärfen. Gerade Holacracy ist ja nicht unumstritten. Wenn man da als Wissenschaftler eine Tiefenbohrung vornimmt, dann ist selbst eine differenzierte Analyse ein Eingriff in die Machtpolitik innerhalb dieser Organisation.
Wie sind Sie dann an Ihre Forschungsobjekte gekommen?
Ich habe den oben zitierten Spruch systematisch auf Managementkonferenzen aufgesagt, bei denen es um Agilität ging.
Da fühlten sich einige so provoziert, dass sie gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt mit kriminellen Rockerbanden verglichen werden.
Über diese Variante haben wir dann Zugang zu fünf sehr unterschiedlichen holakratischen Organisationen bekommen.
Sie stehen Managementmoden eher skeptisch gegenüber. Gleichzeitig halten Sie es für durchaus sinnvoll, bestimmten Moden zu folgen – oder zumindest in der eigenen Organisation so zu tun, als ob. Wie passt das zusammen?
Die Moden sind oft so stark, dass man sich ihnen kaum entziehen kann. Wenn Sie heute Veränderungsprojekte in Ihrer Organisation anstoßen möchten, dann können Sie in der Regel nicht sagen: Na ja, und übrigens würden wir jetzt gerne eine Re-Hierarchisierung vornehmen und zusätzliche Silos bilden – obwohl das in manchen Organisationen durchaus Sinn ergeben könnte. Als Praktiker empfehle ich einen pragmatischen Umgang mit Managementmoden. Also man kann die Dynamik einer Managementmode mitnehmen, indem man sagt: Okay, wir führen ein agiles Change-Management ein und am Ende interessiert sich sowieso keiner dafür, ob unter dem Begriff Hierarchiestufen abgebaut oder zusätzliche eingezogen werden. Man nimmt also das, was gerade en vogue ist – Agilität, Selbstorganisation und so weiter –, und schaut, was die Organisation im Moment wirklich braucht. Ich würde sagen: Liebe Praktiker, springt ruhig auf den Zug auf – aber glaubt nicht alles, was euch die Vertreter einer bestimmten Managementmode einzureden versuchen.
Was raten Sie also Menschen, die ihre Organisationen pragmatisch verändern möchten?
Die eigentlich relevante Frage ist ja, wo der organisatorische Schmerz liegt. Konzentrieren Sie sich auf die Organisationsschmerzen in Ihrem Unternehmen. Vielleicht ist es mangelnde Kooperation und Selbstorganisation – vielleicht aber auch eine zu geringe Spezialisierung. Pauschale Lösungen führen nicht weiter.
Anstatt immer denselben Nagel herauszuholen, um ein bestimmtes Problem zu fixieren, nutzen Sie lieber den gesamte Werkzeugkasten Ihrer Organisation.
Wagen wir abschließend einen Blick in die Glaskugel: Wie wird es in 10 oder 20 Jahren um agile Methoden bestellt sein? Und was wird an ihre Stelle treten?
Ich denke, die Agilität wird sich bald totlaufen und dann in 10 bis 15 Jahren unter einem neuen Begriff wieder auferstehen. Der große Peter Drucker hat einmal gesagt, dass alle aktuellen Managementkonzepte nur kleinere Variationen und Erweiterungen von seit über 100 Jahren bekannten Prinzipien zur Ausrichtung von Organisationen seien – und er hat Recht. Die Geschichte verläuft wellenförmig. Es gibt Phasen der Dezentralisierung und Demokratisierung, in denen Hierarchien und Abteilungsgrenzen eher abgebaut werden – bis man feststellt, dass sich das nicht zu weit treiben lässt, und bestimmte Prinzipien stillschweigend wieder eingeführt werden. Unerwünschte Nebenfolgen treten immer auf, und wir werden den organisatorischen Gordischen Knoten nie ganz durchschlagen.
Über den Autor
Stefan Kühl ist Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. Außerdem arbeitet er als Organisationsberater bei der Firma Metaplan. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter Sisyphos im Management, Brauchbare Illegalität, Das Regenmacher-Phänomen und Der ganz formale Wahnsinn.






