„New Work ist eine Sozialutopie“

Frau Jankowski, Sie schreiben in Ihrem Buch von einer „Spaltung der Arbeitswelt entlang der Linie Old Work und New Work“. Können Sie das konkretisieren?
Jule Jankowski: Viele Unternehmen sind weiterhin sehr klassisch organisiert. Hierarchieebenen, Prozessabläufe, Entscheidungsfindung, wer wie an der Unternehmensentwicklung beteiligt ist – bei all diesen Themen sind einige deutsche Firmen noch sehr im Konventionellen verhaftet. Beziehungsweise wird es partiell umgesetzt. Es lässt sich beobachten, dass Mitarbeitende und Führende in sehr klassisch geprägten Unternehmen mit dem Konzept „New Work“ fremdeln. Das hat meiner Einschätzung nach verschiedene Ursachen. Für empfindliche Ohren hört sich das „Neu“ in New Work danach an, dass alles auf einmal verändern werden muss, dass alles auf dem Prüfstand steht. So kann der Eindruck entstehen, dass das, was bisher war, also „Old Work“ – die Dinge, die wir alle gewohnt sind und täglich anwenden –, ihnen „genommen“ wird. Im Extremfall kann das zu einer Abwehrhaltung führen. Wir sehen ähnliche Dynamiken nicht selten, wenn neue Managementmoden unreflektiert angeordnet werden. Im Ergebnis treibt das New-Work-Enthusiasten und „Klassiker“, denen die bestehenden Strukturen Sicherheit geben und die finden: „Warum etwas ändern, was funktioniert?“, auseinander.

Enthusiasmus trifft es gut, denn alle reden von New Work und man hat das Gefühl, irgendwo in diesem oft etwas diffusen Konzept stecken die Antworten auf alle beruflichen Herausforderungen.
Sie sagen es: Schwierig finde ich es, wenn New Work als Wunderglaube gesehen wird, als Allheilmittel, was Verbesserung verheißt, ohne den konkreten Weg dahin aufzuzeigen bzw. mitzudenken. Das grundsätzliche Problem ist nämlich, dass der Begriff sehr schwammig ist. Vermengt darin wird alles von Remote Work, flexiblen Arbeitszeiten, mehr Tischkicker bis zum veganen Catering am Mittag. Wenn Sie eine Umfrage zum Thema starten, werden Sie unzählige verschiedene Antworten zur Füllung der Idee erhalten. New Work war im Urgedanken eine Sozialutopie, so war es gedacht. Doch von diesen Ursprüngen hat sich New Work meilenweit entfernt.
Die schöne neue Arbeitswelt, in der alles möglich und für jeden etwas dabei ist.
Und sie dient deshalb gerne als Argument, um etwas Neues durchzusetzen. Dazu ein Beispiel: In der Pandemie brauchte es schnelle Lösungen, damit Unternehmen weiter funktionieren konnten. Jetzt sehnen sich einige Unternehmen insgeheim zurück zu Schema F. Sie wollen ihr vertrautes „Old Work“ zurück, denn das kennen sie, dafür sind die Führungskräfte ausgebildet, und das gibt den Mitarbeitenden Sicherheit. Die Menschen sollen also bitte schön wieder ins Büro kommen, das Flurgespräch suchen, „präsent“ sein. Manche Kollegen freut das. Doch vor allem Wissensarbeiter sind da vielfach anderer Meinung. Auch wenn Homeoffice neue Herausforderungen mit sich brachte, haben sie sich damit gut arrangiert und finden es mittlerweile prima.
Take-aways:
- New Work sollte um die Perspektive Good Work ergänzt werden, da es nicht darum geht, alles „neu“ zu machen, sondern zu schauen, wie man gute und zukunftsweisende Arbeitsstrukturen schafft.
- Aktionismus und Enthusiasmus sind Ursache der vielen gescheiterten Projekte in Unternehmen. Nachhaltige Veränderung lässt sich nur durch Planung und mit Strategie erreichen.
- Unternehmen sollten weniger Wert auf ihre Außenwirkung legen, sondern sich darauf konzentrieren, überraschende, positive und gute Leistungen zu erbringen, für Kunden genauso wie für Arbeitnehmende.
Der Begriff New Work stammt von Frithjof Bergmann. Sein Ziel war es, dass Mitarbeitende mehr Entscheidungs- und Handlungsfreiheit haben sollten. Ihm ging es nicht darum, alles grundsätzlich zu verändern …
Genau. Als die US-amerikanische Automobilindustrie zusammenbrach, war klar, dass viele Menschen ohne Lohn und Brot sein würden. Er schlussfolgerte für sich: Das ist doch die Chance, dass die Menschen für sich herausfinden könnten, was sie eigentlich wirklich wollen. Autonomer arbeiten? Selbstbestimmter? In anderen Strukturen? Von daheim aus? Es ging darum, dass die Menschen für sich entscheiden sollten, welche Arbeit in welcher Form und Struktur für sie gut sei und in welcher sie ihr volles Potenzial entfalten können. Bergmann dachte die Entwicklung bis zum Ende und definierte seine Sozialutopie von New Work. Eine Arbeitswelt, in der alle ihrer Bestimmung folgen und diese auch eigenverantwortlich leben können. Auf diesen Kerngedanken sollten wir uns wieder besinnen, ihn als Gedankenimpuls betrachten. Ein paar lustige Möbel im Büro, damit wenigstens irgendwer reinschaut, und ein bisschen mehr Homeoffice für diese und jenen? Das ist doch Infantilisierung. Der Weg dazwischen oder von mir aus auch der Weg dahin ist sicherlich steinig und nicht trivial. Was es braucht, ist eine Brücke zwischen Old und New Work, also eine Antwort auf die Frage: Wie arbeiten wir zukünftig am effektivsten, am besten, am wirksamsten? Das wird in jeder Organisation konsequenterweise anders aussehen.
Was raten Sie Unternehmen, wenn diese Sie in Ihrer Funktion als Organisationsberaterin fragen, wie Sie langfristig erfolgreich sein können?
Widmen Sie sich dem Gedanken von „Good Work“ als Mischung aus den Dingen, die Sie in Ihrer Organisation schon lange mit Erfolg tun, und denen, die innovativ sind – und von Ihren Mitarbeitenden mitgetragen werden.
Warum nicht Altbewährtes als solides Fundament nutzen und darüber hinaus herausfinden, mit welchen neuen Herangehensweisen es sich für die Zukunft am besten ergänzen lässt?
Dazu muss man Annahmen treffen, Hypothesen aufstellen und testen, was am besten funktioniert. Damit das etwas bringt, muss man aber auch bereit sein, Dinge – egal ob neu oder schon lange im Einsatz – wieder fallen zu lassen, wenn sie nicht oder nicht mehr funktionieren. Um beim Beispiel zu bleiben: An welcher Stelle macht Homeoffice Sinn für den Team- und Unternehmenserfolg? Wo braucht es die Menschen vor Ort, wo funktionieren hybride Modelle, wo braucht es physisch niemanden mehr? Hier ist Ehrlichkeit gefragt und auch etwas Flexibilität. Wer ausprobiert, mitunter vielleicht fast spielerisch, wird hier sehr schnell zu den richtigen Antworten für die eigene Organisation kommen.
Wo fange ich, als Führungskraft, damit am besten an?
Hören Sie auf damit, das Mantra vom „Alles wird neu“ aufzusagen. Denn: Das ist oft gar nicht nötig und verwirrt die Leute nur. Reden Sie stattdessen darüber, dass Sie die Dinge zum Guten hin verändern und Abläufe, Regelungen, vielleicht am Anfang nur so kleine Dinge wie Meetings zusammen besser machen wollen. Sprechen und diskutieren Sie mit den Menschen darüber, was man optimieren könnte und welche Innovationen sich dazu bewährt haben. Tragen Sie aber auch zusammen, was aus der Vergangenheit als solide Basis weiterhin Bestand haben soll. Und dann testen Sie die richtige Mischung. Es ist eigentlich egal, wo Sie konkret anfangen. Wichtig ist, dass Sie mit Bedacht vorgehen, die Leute involvieren und kleine – aber verbindliche – Schritte testen.
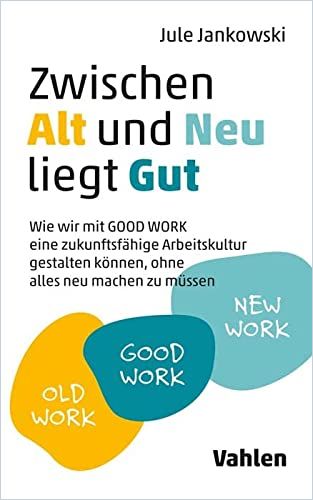
Menschen tun sich grundsätzlich schwer mit Veränderung … Wie ist das eigentlich bei Ihnen persönlich?
(Lacht.) Ich selbst tue mich enorm schwer mit Veränderungen. Aber konservativ bin ich eigentlich nicht – ich weiß: Es braucht Veränderungen. Aber es braucht auch einige wichtige Konstanten. Die Veränderungen in meinem Leben betrachte ich heute als „Wachstumsfugen“ und die Konstanten sehe ich als Halt. Und ganz grundsätzlich hilft es mir, mir immer wieder zu sagen: Veränderungen sind nicht per se schwierig. Wenn Sie morgen 20 Millionen im Lotto gewinnen, wird sich Ihr Leben sicher verändern. Aber ist das schlecht?
Das kommt darauf an, wie viel Bedeutung man der Statistik zuweist, dass die meisten Lotto-Millionäre nach wenigen Jahren wieder bettelarm sind.
Das ist ein schöner Hinweis: Viele Leute würden beim Gewinn der 20 Millionen gar nicht daran denken! Es sind eben die Veränderungen, die mit Ungewissheit, einem unguten Gefühl einhergehen, die wir nicht mögen. Die uns aus der Komfortzone locken. Und grundsätzlich gilt: Wir mögen Gewohnheiten und Routinen, weil sie uns eine gewisse Sicherheit vermitteln – oder vorgaukeln. Unvorhergesehene, herausfordernde Veränderungen jedoch stressen uns. Noch schlimmer sind nur erzwungene Veränderungen, bei denen man selbst das Gefühl hat, kein Mitspracherecht zu besitzen.
Das mit den Konstanten ist ein wichtiges Thema. Viele Menschen haben diese nicht oder nicht mehr. Heute leben wir in einer Welt, die geprägt ist von Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit …
Ja, natürlich, das wird uns auch immer als neu und gerade einzigartig präsentiert. Richtig ist aber doch: Wir haben niemals in einer Welt voller Gewissheit gelebt. Aktuell ist die Dynamik zwar hoch, viele haben das Gefühl, im Dauerkrisenmodus zu agieren. Konstanten sind damit aber nur noch wichtiger geworden! Und damit die Fähigkeit, diese selbst zu schaffen. Ihr Arbeitgeber wird Ihnen ein paar Konstanten vermitteln, aber mehr versprechen, als er halten kann, sollte er nicht. Sie sind am Zug. Sie müssen das Heft selbst in die Hand nehmen: Konstanten können Freunde sein, Ihre Familie, ein Hobby, auch Dinge wie der Wald, in dem Sie täglich 20 Minuten spazieren gehen. Das Samstagsritual mit Ihren Kindern. Orte, Dinge, Menschen, Handlungen, bei denen Sie sich sicher und zufrieden fühlen. Im Grunde haben wir alle solche Konstanten, sie sind uns vielleicht nur nicht richtig bewusst. Denn:
Jeder Mensch braucht einen Safe Space.
Fragen Sie sich: Was ist das bei Ihnen? Ein Ort, ein Mensch, ein Hobby? Das ist ein Anfang, um sich Ihrer Konstanten bewusst zu werden, und mit etwas mehr Achtsamkeit werden Sie dann weitere entdecken. Was Sie nicht tun sollten: Darauf bauen, dass Ihnen diese Konstanten irgendwer liefert oder sogar liefern muss. Das ist Ihr Ding.
Gleichwohl versuchen es gerade viele Arbeitgeber, etwa indem sie die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro beordern, um den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu fördern – wieder „mehr Struktur zu geben“. Was halten Sie davon?
Ganz ehrlich: Ich glaube, damit schießen sich viele Firmen ein Eigentor – aber die Argumentation ist natürlich naheliegend. Die Unternehmen fragen sich: Wie bekommen wir die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro? Und die Antwort kommt dann fürsorglich daher: Hier hast du mehr Halt und Konstanz, wir kümmern uns um dich. Das Ganze ist in etwa so erfolgversprechend, wie zu versuchen, Zahnpasta in eine ausgedrückte Tube zurückzuquetschen.
Wieso?
Sicher kann ein Unternehmen darauf drängen, dass die Menschen wieder fünf Tage in der Woche an ihren Schreibtischen im Office sitzen. Aber viele Menschen wollen flexibler und autonomer sein. Das hat man in der Coronakrise sogar von ihnen verlangt und sie haben bewiesen, dass es geht. Nun sollen sie das wieder hergeben und sie fragen zu Recht: Warum? Auch hier gilt, was ich eben schon sagte: One Size Fits All – egal ob vollständig im Office oder vollständig von daheim – ist „Old Work“. Good Work wäre, möglichst viele Freiräume zu lassen und denen, die das nicht wollen, Optionen zur Rückkehr zu bieten. Viele Firmen haben deshalb sogenannte Flexi-Desks eingeführt, die man – sofern man sich bis 24 Stunden vorher angemeldet hat – im Büro nutzen kann, aber eben nicht täglich nutzen muss.
Was ist der größte Fehler, den Unternehmen in diesem Zusammenhang Ihrer Ansicht nach machen?
Diese Sache mit „zwei Tage Homeoffice und drei Tage im Büro“, bei denen es einen fixen Tag gibt, an dem alle gleichzeitig da sein sollen, damit sie sich „besser spüren“. Eine Regelung zu finden, ist prinzipiell erst einmal nicht schlecht. Doch holzschnittartige Vorgaben, ohne die Realitäten der Mitarbeitenden zu berücksichtigen, sind mittelmäßige Lösungen. Die Praxis zeigt, dass dieser Tag schnell zu einer „Silent Disco“ verkommt: Alle haben dann ihre Kopfhörer auf. Sie reden über Videocalls miteinander, ins Nebenzimmer, weil sie die Kollegen und Kolleginnen, mit denen sie weltweit in einem Team organisiert sind, nicht benachteiligen wollen. Oder mit Kunden und Kundinnen, Partnern, die auf der ganzen Welt zu Hause sind. Das sind logische Konsequenzen unserer nach wie vor sehr funktional getrennten Arbeitswelt mitten in der Globalisierung. Was vielen Firmen, die ich berate, fehlt, ist eine unverkrampftere Art, die digitale Balance zu finden. Sie sollten aufhören, die Unterschiede zwischen analog und digital ständig zu betonen. Die bestehen nicht mehr! Wir haben schon lange begonnen, das Digitale in unsere analoge Welt zu integrieren. Noch haben wir alle ein Handy, eine Webcam, einen oder zwei Bildschirme – doch absehbar ist auch schon: Irgendwann wird auch das durch eine neue Technologie ersetzt.
Wir werden vielleicht Brillen tragen, mit denen wir mit der ganzen Welt kommunizieren. Augmented Reality wird zum neuen Standard und wir werden zwischen analog und digital ohnehin nur noch bedingt differenzieren können.
Damit sind wir bei einem Thema, das gerade in vielen Branchen ein Erdbeben verursacht und die Arbeitnehmenden verunsichert: ChatGPT und immer mehr KI-Unterstützung an den Arbeitsplätzen.
Was ChatGPT betrifft, erlebe ich gerade ein echtes Deutungshoheitsgerangel. Jeder meint, seinen Senf dazugeben, irgendwie „dabei sein“ zu müssen. Und jeder wird hier zum „Experten“ und weiß, was die Einführung dieser Technologie für die Menschen bedeutet. Ich muss da immer an einen Erdbeerjoghurt aus dem Supermarkt denken. (Lacht.)
Wie bitte?
Es gibt da dieses Experiment, bei denen man Kindern, die zuvor ausschließlich das künstliche, mit Erdbeeraromen versetzte Zeug gegessen haben, zum ersten Mal einen Naturjoghurt mit echten Erdbeeren zum Testen gegeben hat. Die Reaktion war: Pfui, das schmeckt überhaupt nicht nach Erdbeeren! Die KI-Tools, die vorgeben, uns nun zum Beispiel das Schreiben und Designen abzunehmen – bislang ziemlich denk- und zeitaufwändige Arbeiten –, lassen uns verlernen, das Handgemachte zu lieben. Schnell sind wir begeistert vom künstlichen Ersatz, der gerade im großen Stil angerührt wird – billig, schnell, überall zu kriegen. Das sind paradoxerweise oft dieselben Leute, die bei jeder Gelegenheit vom „Skin in the Game“, der in Firmen so unerlässlich sei, reden. Ich glaube also, hier müssen wir enorm aufpassen. KI wird unsere mutmaßliche Wahrnehmung und Sensibilität für Qualität von Texten oder Bildern beeinflussen, das können wir nicht verhindern. Gleichwohl gilt: Wer die Handarbeit und das damit verbundene Denken und Lernen handstreichartig auslagert, darf sich am Schluss nicht wundern, wenn die Innovation auf der Strecke bleibt. Auch hier gilt wieder: Ja, integrieren wir das Neue, wo es Sinn macht. Aber löschen wir das Alte nicht einfach aus.
Das erinnert mich an eine Aussage aus Ihrem Buch: „Es braucht eine Prise Marrakesch in unserer Arbeit.“ Was bedeutet das im Licht des eben Diskutierten?
Es gibt in Marrakesch den Platz der Gaukler, eine absolute Touristenattraktion. Je weiter Sie jedoch von hier in die Stadt hineinlaufen, desto finsterer und enger werden die Gassen. Sie laufen an fensterlosen Häusern vorbei, sind umgeben von hohen Mauern, die dann und wann eine kleine Holztür haben. Wie in einem Labyrinth. Bei unserem ersten Besuch in der marokkanischen Hauptstadt hatten wir zum Glück einen Führer, der uns zu unserem Hotel gebracht hat, denn auch wir mussten durch so eine Tür – und die sehen für Fremde natürlich alle gleich aus! Danach liefen wir noch zwei, drei Meter durch einen dunklen Gang und dann, ganz plötzlich, standen wir in einem wunderschönen, hellen Innenhof unter blauem Himmel. In der Mitte ein sprudelnder Brunnen, und man reichte uns direkt frischen Tee. Wir waren sprachlos, weil einfach so überrascht.
Was hat das mit unserer Arbeitswelt zu tun?
In Europa und auch in anderen westlichen Ländern legen wir Wert auf tolle Fassaden. Prunkvolle Gebäude, viel Glas, viel Pomp. Und kaum ist man drinnen, wird es schlicht, radikal funktional und langweilig, werden die Menschen unfreundlich. Gleiches gilt für unsere Arbeitsweise: Wir polieren gerne an unserem Image herum, legen Wert auf die Außenwirkung, aber um den Kern bemühen wir uns meist viel weniger. Ich behaupte: Wir sollten uns mehr auf das Überraschende, Entgegenkommende konzentrieren, mehr Wert auf Herzlichkeit legen. Wir sollten ins Herz von Organisationen, ihre Kultur der Zusammenarbeit und des Lernens, investieren, denn das entscheidet letztlich über den Unternehmenserfolg.
Über die Autorin:
Jule Jankowski ist systemische Organisationsberaterin und führt die Beratungsfirma Humiq.










