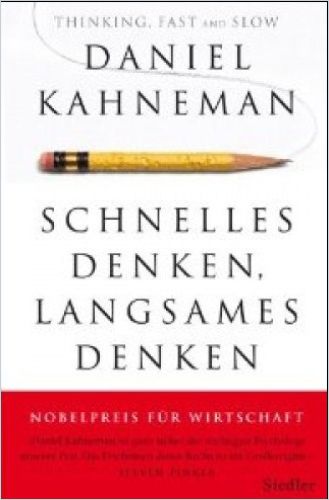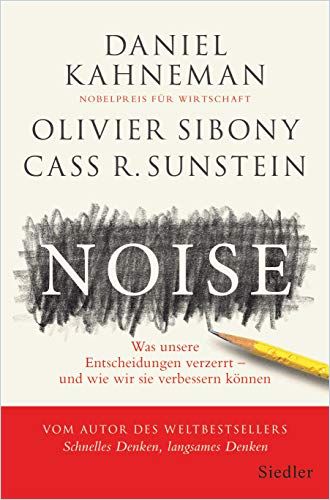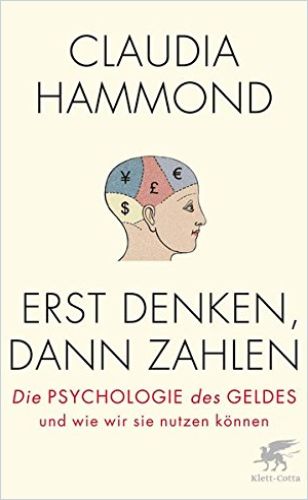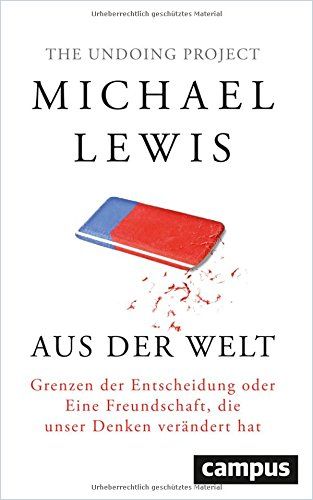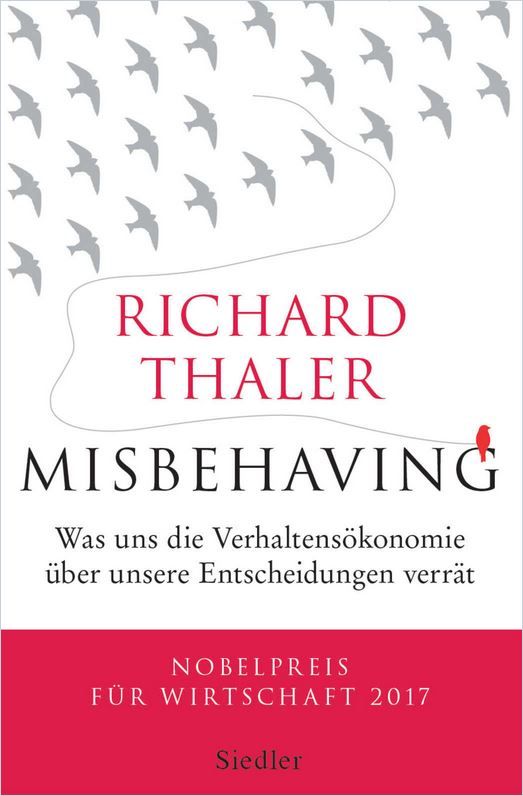„Nicht Technologie macht das Silicon Valley so mächtig, sondern Psychologie.“

Herr Imseng, alle reden von flacheren Hierarchien, Sie plädieren in Ihrem neuen Buch stattdessen für die Einführung eines CBO – eines Chief Behavioral Officers. Warum?
Dominik Imseng: Weil ein Chief Behavioral Officer nur Ausdruck gesunden ökonomischen Menschenverstands ist. Im Zentrum des Handelns jedes Unternehmens stehen die Entscheidungen von Kunden, die zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung bewegt werden sollen. Wenn Unternehmen die psychologischen Erkenntnisse der Verhaltensökonomie – also der Wissenschaft vom Entscheiden – ignorieren, ignorieren sie damit auch Wachstumspotenziale. Oder sie wirtschaften gar völlig an den Kunden vorbei. Darum plädiere ich in meinem Buch für die konsequente Nutzung der Erkenntnisse von Verhaltensökonomen wie Daniel Kahneman, Richard Thaler oder Dan Ariely im Business. Denn nur wer weiß, wie Kunden Entscheidungen treffen, weiß auch, was Kunden wollen.
Aber braucht es dafür wirklich eine neue Kraft auf C-Level?
Es braucht zumindest jemanden, der in der Organisation genug Autorität hat, um diesen Wandel hin zu mehr „Behavioral Intelligence“ voranzutreiben. Idealerweise ist das jemand aus der obersten Führungsetage. Vorstellbar ist aber auch eine neue Stabsstelle. Am Ende ist entscheidend, wie „erwachsen“ eine Organisation im Hinblick auf die Nutzung der Erkenntnisse der Verhaltensökonomie schon ist und wie tiefgreifend der Wandel sein muss, um zur „Behavioral Company“ zu werden. Wenn ein einzelner Mitarbeiter die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie nutzt, ist das wertvoll. Wenn eine ganze Organisation das tut, ist es transformativ.
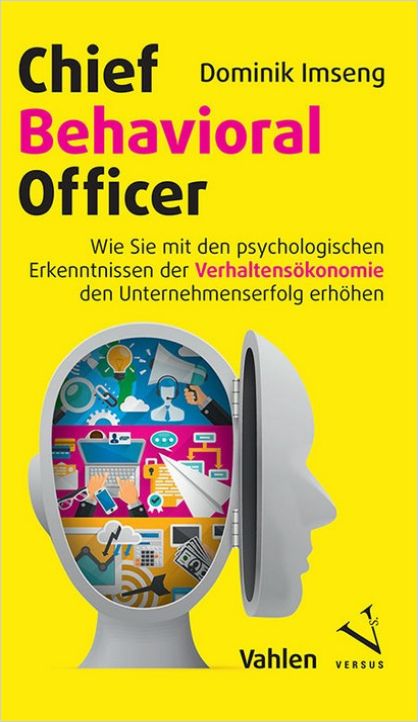
In Europa hört man nur selten von Unternehmen, die die Erkenntnisse von Kahneman, Thaler & Co. nutzen. Sie behaupten aber, dass es in den USA schon einige Firmen gibt, die damit gute Erfahrungen machen.
In der Tat. Im Silicon Valley etwa nutzt man die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie schon lange – mit beeindruckenden Ergebnissen. Tatsächlich wage ich zu behaupten, dass nicht Technologie das Silicon Valley so mächtig macht, sondern Psychologie. Nehmen wir Uber. Bis vor wenigen Jahren war das gewöhnliche Taxi die perfekte Lösung für ein dringendes Problem: Wie komme ich schnell, bequem und sicher von A nach B? Seit Uber ist das traditionelle Taxi nicht mehr die Lösung für dieses Problem, sondern selbst das Problem. Warum? Ich frage Sie: Was sind die ersten drei Dinge, die Sie sehen, wenn Sie in ein Taxi steigen?
Die ID-Karte des Fahrers, den Wunderbaum am Rückspiegel – und das rot leuchtende Taxameter.
Ganz genau. Die Tatsache, dass dieser Zähler etwa in Zürich schon bei 8 Franken steht, wenn der Taxifahrer losfährt, und fortan steigt und steigt und steigt – selbst wenn Sie im Stau stehen –, lässt Sie das spüren, was Verhaltensökonomen „Pain of Paying“ nennen.
Tatsächlich zeigen Brain-Scans, dass die Schmerzzentren in unserem Hirn aktiviert werden, wenn wir ans Geldausgeben denken müssen.
Dominik Imseng
Die Verhaltensökonomen bei Uber haben diesen „Schmerzpunkt“ erkannt und darum dafür gesorgt, dass die App von vornherein klar macht, wie teuer die Fahrt werden wird – egal, an wie vielen Ampeln Sie stehen oder welche Straßensperrungen umfahren werden müssen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Taxis lässt Sie Uber auch nicht im Unklaren, wann der Fahrer kommt, ob er überhaupt kommt und wie lang die Fahrt dauern wird. Denn die Verhaltensökonomie weiß: Wir Menschen hassen Unsicherheit. Ein psychologisches Phänomen, das als „Ambiguity Aversion“ bekannt ist. Sie sehen: Wenn Unternehmen wissen, wie Menschen „ticken“, dann können sie darauf aufbauend attraktive neue Angebote entwickeln und mitunter, wie im Fall von Uber, ganze Branchen umkrempeln.
Take-aways:
- Nur wer weiß, wie Kunden Entscheidungen treffen, weiß auch, was Kunden wollen.
- Klassische Marktforschung kann zu verzerrten Ideen von angeblichen Kundenwünschen führen – die Verhaltensökonomie kann Fehljustierungen an Produkten vermeiden helfen.
- Der „Confirmation Bias“, die Bestätigungsverzerrung, ist eine der größten Gefahren für Unternehmen in Konkurrenzsituationen.
Wenn die Nutzung der Erkenntnisse der Verhaltensökonomie so profitabel sein soll: Warum gibt es dann bei uns noch so wenig Chief Behavioral Officers?
Der Hauptgrund ist wohl, dass europäische Unternehmen immer ein paar Jahre länger brauchen als amerikanische, um einen neuen Mindset zu entwickeln – siehe das Thema Digitalisierung. Wenn mein Geschäftspartner Marcus Gretener und ich mit Firmen zusammenarbeiten, stellt man uns oft die Frage, warum man nicht einfach gute alte Marktforschung betreiben könne. „Wir fragen die Kunden, und die sagen uns dann schon, was sie wollen.“ Klingt vernünftig, funktioniert aber nicht immer. Viele der Befragten wissen oft nicht, was sie antworten sollen, oder sagen das, was „irgendwie richtig“ klingt oder was sie meinen sagen zu müssen. Ein Beispiel: Auf die Frage „Sollte man weniger Fleisch essen?“ antworten 80 Prozent der Befragten mit „Ja, klar“. Am Kühlregal greifen dieselben Leute dann aber trotzdem zu ihren geliebten Chicken-Nuggets statt zur Plant-based-Alternative, die Ihr Unternehmen aufgrund der vermeintlich „klaren Marktforschungslage“ entwickelt hat – der sogenannte „Attitude-Behavior Gap“.
Das heißt: Marktforschung forscht mitunter am Markt vorbei?
Das kann passieren. Es gibt ja das schöne Zitat des Werbers David Ogilvy: „Das Problem bei der Marktforschung ist, dass die Menschen nicht denken, was sie fühlen, nicht sagen, was sie denken, und nicht tun, was sie sagen.“ Ein weiteres Problem erkannte Henry Ford: „Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“
Das ist 100 Jahre her. Haben Sie ein aktuelleres Beispiel?
Nehmen wir den Erfolg von Dyson. Als man die Leute vor 20 Jahren fragte, ob sie einen Staubsauger zum fünffachen Preis ihres jetzigen Modells kaufen würden, sagten sie unisono: „Warum denn? Ein Staubsauger muss zwar ordentlich saugen, aber dafür gebe ich kein Vermögen aus. Und warum sollte er cool aussehen? Die meiste Zeit steht er ja sowieso im Schrank!“ Doch siehe da: Kaum hatte James Dyson bewiesen, dass auch ein Staubsauger ein technologisches Wunderwerk und Designobjekt à la iPhone sein konnte, entstand eines der erfolgreichsten Produkte der letzten 20 Jahre.
Gut, einverstanden. Welche Abteilungen sind jenseits der Produktentwicklung besonders geeignet, um verhaltensökonomische Erkenntnisse gewinnbringend einzusetzen?
Grundsätzlich profitieren alle vier Marketing-P davon, dass man sie mit den psychologischen Erkenntnissen der Verhaltensökonomie richtig ausrichtet: Product, Price, Place und Promotion.
Dominik Imseng
Product hatten wir schon mit den Beispielen Uber und Dyson. Gehen wir über zum Preis, einem entscheidenden Faktor, wenn es um das Verhalten von Kunden geht. Fatal ist hier, dass viele Unternehmen mit dem falschen Pricing Geld verlieren. „Das sind unsere Stückkosten, jetzt schlagen wir die anvisierte Gewinnmarge drauf, und fertig ist der Preis.“ Dieses Cost-Plus-Pricing ignoriert komplett, dass sich die Zahlungsbereitschaft von Kunden gezielt beeinflussen lässt. So wie das die Verhaltensökonomen bei Nespresso geschafft haben.
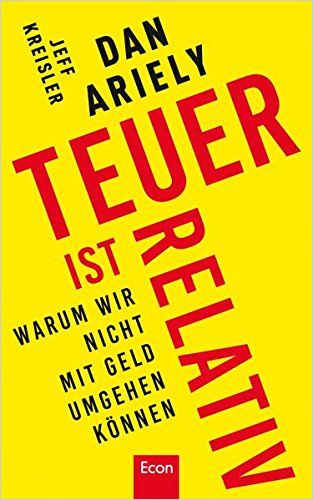
Was haben die gemacht?
Holen Sie mal ein scharfes Messer und öffnen Sie damit vorsichtig eine Nespresso-Kapsel. Sie werden darin zwischen 5 und 6 Gramm gemahlenen Kaffee finden. Da eine Kapsel im Durchschnitt 37 Cent kostet, kommt Sie also das Kilo Nespresso-Kaffee um die 60 Euro zu stehen – rund viermal so viel, wie ein Kilo gemahlener Kaffee normalerweise kostet. Warum um alles in der Welt sind Sie trotzdem bereit, 37 Cent für eine Tasse Nespresso zu bezahlen? Nein, nicht nur wegen der langjährigen Werbung mit George Clooney. Sondern weil Nestlé bei der Einführung von Nespresso in den 1980er-Jahren geschickt den „Anchoring Bias“ nutzte. Konkret: Nestlé profitierte davon, dass damals niemand wusste, welcher Preis für eine Tasse Nespresso-Kaffee überhaupt angemessen war. Also verglichen die Konsumenten die 37 Cent für einen Nespresso zu Hause mit den 2 Euro für eine Tasse Kaffee im Restaurant – und fanden darum den Nespresso zu Hause geradezu ein Schnäppchen. Entscheidend für den riesigen Erfolg von Nespresso war also der schlaue Produktdesign-Entscheid: eine Nespresso-Kapsel = eine Tasse Kaffee. Denn so wurde verhindert, dass die Konsumenten den Kilopreis von Nespresso mit dem von gewöhnlichem Kaffee verglichen – und Nespresso darum viel zu teuer fanden.
Sie kommen aus der kreativen Werbung. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie für Ihre Kunden hochrelevant sind?
Das war 2008, als Marcus Gretener und ich Nudge von Cass Sunstein und Richard Thaler lasen, quasi die erste Bibel der angewandten Verhaltensökonomie. Darin findet sich ein Beispiel aus den USA, wo es darum ging, in einer Schulkantine dafür zu sorgen, dass sich die Kinder gesünder ernähren. Als Werber hätte ich da als Erstes ein paar Plakate aufgehängt und versucht, die Kids mit knackigen Schlagzeilen und appetitlichen Bildern für mehr Gemüse und Obst zu begeistern. Allerdings wohl erfolglos. Die Kids hätten zwar die Botschaft verstanden, aber sie hätten ihr Essverhalten trotzdem nicht verändert. Viel effizienter war da das Vorgehen der Verhaltensökonomen in Nudge.
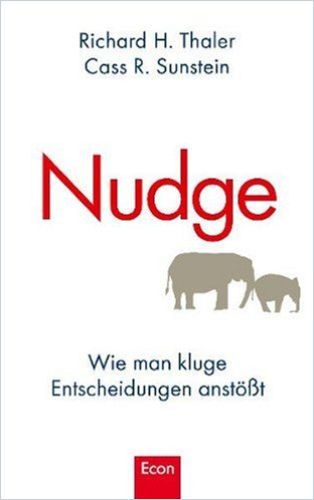
Sie ordneten nämlich einfach in der Schulkantine das Angebot anders an: Gemüse und Obst auf Augenhöhe im ersten Auslagewagen, Hamburger und Pommes weiter die Selbstbedienungszeile runter. Und siehe da: Auf einmal war das Essen, das die Kinder auf ihre Teller schaufelten, viel gesünder. Seither bin ich fasziniert von dem, was Verhaltensökonomen „Choice Architecture“ oder auch „Behavioral Design“ nennen: das bewusste Gestalten von Entscheidungen und Verhalten. Und:
Jeder Marketer, der mit weniger Aufwand mehr erreichen möchte, sollte meine Begeisterung für Verhaltensökonomie teilen.
Dominik Imseng
Um die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie im Business zu nutzen, empfehlen Sie in Ihrem Buch die 3B-Methode von Dan Ariely. Was hat es damit auf sich – und wie setzt man sie richtig ein?
Die drei B stehen für Behavior, Barriers und Benefits. Beim ersten B – Behavior, also Verhalten – geht es darum, sich klarzumachen, welches Kundenverhalten Sie erzielen möchten. Was genau sollen Kunden tun? Nicht „denken“, „in Betracht ziehen“ oder „sich vornehmen“ – sondern tatsächlich tun? Wichtig ist dabei, dass Sie bei der Definition des gewünschten Verhaltens so spezifisch und messbar wie möglich sind. Ein Kundenkonto zu eröffnen, reicht als Zielverhalten nicht aus. Sie wollen, dass Kunden ein Konto eröffnen und z. B. zweimal im Monat für 100 Euro einkaufen.
Und die Barriers, die Barrieren?
Bei den Barriers geht es darum, herauszufinden, was im Moment noch verhindert, dass sich Ihre Kunden so verhalten, wie Sie das möchten. Und natürlich geht es hier auch um die Anschlussfrage: Wie lassen sich diese Barrieren abbauen? Denken Sie zum Beispiel an das Scheitern von Google Glass zurück.
Konkreter?
Vor zehn Jahren wurde Google Glass als völlig neue Möglichkeit angepriesen, einen Computer zu nutzen: Brille auf, Hände frei zum Navigieren, Videotelefonieren, Fotografieren usw. Augmented Reality wie aus einem Science-Fiction-Film. Warum war Google Glass trotzdem ein Rohrkrepierer? Weil die Barrieren nicht sauber analysiert wurden. Die richtigen Fragen wären gewesen: Was ist mit dem Datenschutz? Wie weiß ich, ob mich gerade jemand filmt oder vielleicht sogar streamt? Diese Bedenken haben bei der ersten Präsentation von Google Glass so schnell die Runde gemacht, dass noch vor Marktstart für die Träger dieser neuen Datenbrille der Begriff „Glasshole“ erfunden war. Eine weitere nicht zu unterschätzende Barriere war, dass man mit diesem Hightechding auf der Nase komplett bescheuert aussah. Ein Umstand, der die Nerds bei Google – allen voran Larry Page und Sergey Brin – nicht kümmerte, die meisten „normalen“ Menschen aber schon.
Immerhin: Beim Benefits-B konnte Google Glass punkten. Technologisch war das Wearable ein Geniestreich.
Das stimmt. Die gängigen Vorteile „gut und günstig“ bietet ja auch die Konkurrenz an.
Unternehmen sollten darum tatsächlich von Google lernen und regelmäßig Side Projects mit Wachstumspotenzial starten.
Dominik Imseng
Sie meinen: Sie reiten weiterhin Ihren alten Gaul – Ihr angestammtes Business, das aber immer weniger profitabel wird – und nebenher lassen Sie ein neues, schnelles Pony galoppieren, auf das Sie zuerst ein Bein stellen, um irgendwann vielleicht ganz umzusatteln?
Genau so. Und das Beste: Das vermeintliche Pony entpuppt sich dann vielleicht sogar als Vollblüter!
Kürzlich habe ich von einer ehemals beinahe insolventen italienischen Schiffswerft gelesen, die in Genua nach dem Zusammensturz der alten Autobahnbrücke in Rekordzeit eine neue – aus Stahl – fertigte. Die Werft ist heute auf Jahre hinaus ausgebucht mit den Bestellungen von Stahlbrückenteilen aus ganz Europa.
Ein schönes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen seine Kompetenzen breiter denken kann. Diese Fähigkeit, gleichsam über den Tellerrand zu blicken, kann eine weitere Folge der Beschäftigung mit Verhaltensökonomie sein. Denn durch die Methode des „Debiasing“ lassen sich kognitive Verzerrungen vermeiden, die den Erfolg von Unternehmen limitieren, ja sogar verhindern. Dazu gehört z. B. der „Confirmation Bias“. Er bezeichnet die Tendenz, Informationen und Argumente auszufiltern, die nicht mit unseren bestehenden Überzeugungen in Einklang stehen. Statt wie ein unparteiischer Richter verhalten wir uns wie ein parteiischer Anwalt. Unternehmen müssen diese „Bestätigungsverzerrung“ unbedingt in Schach halten. Sonst könnte es ihnen wie dem CEO von BlackBerry ergehen, dem die Lancierung des ersten iPhone keine schlaflosen Nächte bereitete. „Warum auch? Wir haben die bessere Batterieleistung, die bessere Tastatur, die besseren Sicherheitsstandards“, wurde er nicht müde zu betonen und filterte hartnäckig alle Warnsignale aus. Wie falsch er damit lag, können wir mit einer einfachen Frage beantworten: Wann hatten Sie das letzte Mal einen BlackBerry in der Hand?
Ich verstehe: Ein Chief Behavioral Officer kann auch als hartnäckiger Fragesteller und radikaler Aufklärer wertvolle Dienste leisten. Wie schafft er es aber in dieser eher ungemütlichen Rolle, sich nicht sofort überall unbeliebt zu machen?
Wie bei jedem Change-Prozess hilft auch bei der Reise hin zu mehr „Behavioral Intelligence“, wenn man eine inspirierende Vision entwickelt, die die Leute begeistert und mitträgt. Ein CBO, der dieses Kürzel verdient, wird sich darum täglich an das Zitat des großen französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry erinnern: „Wer will, dass die Menschen ein Schiff bauen, muss in ihnen die Sehnsucht nach der endlosen Weite des Meeres wecken.“
Über den Autor
Dominik Imseng ist Mitinhaber der Beratungsagentur Smartcut Consulting. Seine Schwerpunkte sind Produktentwicklung, Marketing und Customer Experience.