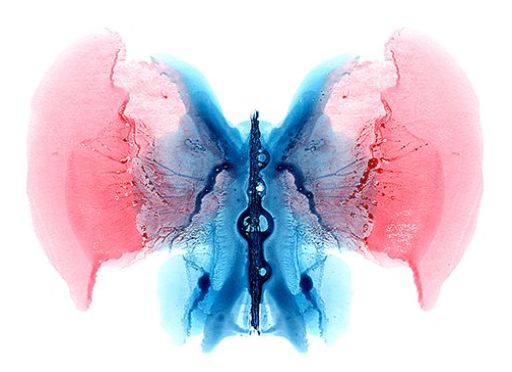In der Präsenzfalle

Präsentismus, das ist das Arbeiten trotz Arbeitsunfähigkeit. In einem weiteren Sinne jedoch auch die „Arbeit trotz psychischer Abwesenheit“, sprich: Man arbeitet, obwohl man nicht voll leistungsfähig ist. Dafür muss man keine Grippe mit Fieberkrämpfen haben – auch Schlafmangel oder Kopfschmerzen führen zu einer verminderten Leistungsfähigkeit.
Eine repräsentative Studie von 2018 hat ergeben, dass nur ein Viertel der Schweizer Erwerbstätigen bei Krankheit zu Hause bleibt. Die Studie untersuchte das Verhältnis der arbeitsbezogenen Belastungen und Ressourcen von Berufstätigen, den sogenannten Jobstress-Index. Dieser hat sich 2020 verschlechtert: Drei von zehn Erwerbstätigen gaben an, kontinuierlich mehr Belastungen als Ressourcen zu haben, nahezu ein Drittel ist emotional erschöpft. Das wird beim Coronajahr 2020 wohl keinen überraschen.

Ich kann nicht mehr, Chef!
Harvard Business ManagerÜberall war zu lesen, dass das erzwungene Homeoffice zwar Vorteile bietet, es aber auch vielen Menschen schwerfällt, die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben zu ziehen, wenn sie räumlich nicht mehr vorhanden ist. Und wenn wir schon 2018, also prä-Corona die Tendenz hatten, unsere privaten, sprich gesundheitlichen Probleme unbewusst mit zur Arbeit zu bringen, wie sieht es dann wohl in einer Zeit aus, in der man nicht mehr nur krank genug sein muss, um nicht aus dem Haus zu können, sondern gar nicht mehr imstande sein darf, auf der Couch sitzend Dinge mit dem Laptop zu erledigen? Keine Frage: Die zuvor schon hohe Hemmschwelle steigt weiter, und man überlegt sich jetzt vier- statt vielleicht zweimal, ob man wirklich krank genug ist.
Die Gründe für Dauererreichbarkeit
In entsprechenden Umfragen wiederholen sich einige Begründungen für das Arbeiten trotz minderer Leistungsfähigkeit: mangelnde Stellvertretungen, Angst, die Kollegen im Stich zu lassen, oder gar davor, den Job zu verlieren. Das sind durchweg nachvollziehbare sowie naheliegende Gründe für Präsentismus. Doch daneben ist noch von einem anderen die Rede: dem Pflichtgefühl. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: dem schlechten Gewissen. Nicht nur vor dem Chef, auch und vor allem vor sich selbst hat man die liegen gebliebene Arbeit zu rechtfertigen. Wen überrascht es da, dass wir im Zweifel lieber eine Aspirin nehmen und weitermachen?
Präsentismus ist kein neues Phänomen. Vielen Arbeitgebern ist bewusst, zu welchen Produktivitätseinbußen es führt – zu größeren nämlich als der Absentismus, also das übermäßige Fehlen bei der Arbeit.
Unternehmen und Vorgesetzte geben sich also große Mühe, den Mitarbeitern Sicherheit zu vermitteln und im Krankheitsfall verständnisvoll zu reagieren. Trotzdem haben viele Arbeitnehmer ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich krankmelden. Wo die anderen Gründe für Präsentismus einleuchten und eine durchaus rationale Basis haben, ist das schlechte Gewissen etwas, was wir nur schwer rational begründen können. Es scheint komplexer, weitreichender. Eigentlich wissen wir, dass es in Ordnung ist, zu fehlen, wenn wir krank sind. Aber wirklich ernst nehmen wir die Signale unseres Körpers in solchen Fällen nicht.
Wer anfällig ist – und wer nicht
Wer in seiner Arbeit Erfüllung und Sinn findet, leistet mehr. Und er leistet nicht, weil er muss, sondern weil er will. Die Frage, ob man genug geleistet hat, stellt sich in diesem Fall gar nicht. So schreibt Nico Rose (neben vielen anderen), dass Arbeiter, die ihre Arbeit als sinnvoll empfinden, nicht nur erwiesenermaßen mehr Engagement und Begeisterung zeigen, sondern auch zufriedener und resilienter sind – und damit etwa für Burn-out-Symptome weniger anfällig.
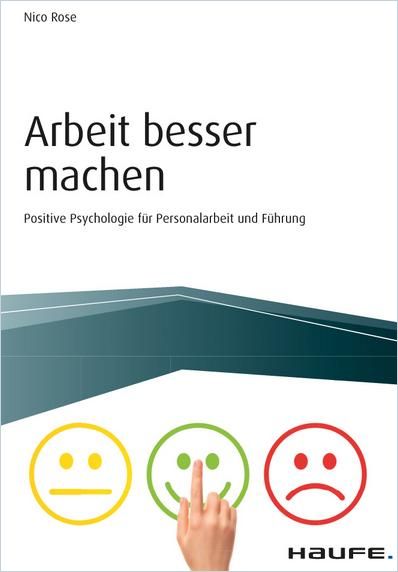
Jemand, der hingegen Dienst nach Vorschrift tut, ist auf äußere Anhaltspunkte angewiesen, die ihm zeigen, dass er seine Arbeit gut macht. Fehlen die, ist man sich dessen plötzlich nicht mehr so sicher – und das Potenzial für ein schlechtes Gewissen steigt. Wenn man dann noch sieht, wie die Kollegen in ihrem Job aufgehen, fühlt man sich vielleicht noch schlechter dabei, in derselben Arbeit nicht dasselbe zu sehen. Sich dann einen freien Tag zu gönnen, wenn man doch eigentlich „nur etwas Kopfschmerzen“ hat und vielleicht „hie und da niesen“ muss, scheint plötzlich unverhältnismäßig. Man traut sich selbst nicht über den Weg. Und entscheidet sich im Zweifel gegen sich.
Allgemein wird eher der Absentismus mit einem fehlenden Sinnempfinden bei der Arbeit in Verbindung gebracht. Zweifellos kann eine mangelnde Begeisterung dazu führen, dass man der Arbeit so oft es geht fernbleibt. Und auch umgekehrt ist es natürlich logisch zu sagen, dass ein großes Engagement schneller in Überstunden umschlägt. Doch beide Erklärungen übersehen den Zusammenhang zwischen dem „Pflichtgefühl“ als genannter Ursache für Präsentismus und dem Aspekt des schlechten Gewissens. Wo Arbeitnehmer ihre Ferientage mit Bedacht einsetzen, Dinge wie Arzttermine und das Abholen der Kinder aufgearbeitet werden müssen, ist es ein Luxus, ein Privileg, der Arbeit fernzubleiben. Und manche Menschen beanspruchen Privilegien weniger selbstverständlich als andere.
Wider das schlechte Gewissen
Der naheliegendste Weg, dem schlechten Gewissen entgegenzuwirken, wäre demnach also, das Sinnempfinden und damit die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Ein erster Schritt könnte sein, Mitarbeiter anzuregen, sich regelmäßig und ernsthaft mit dem eigenen Jobprofil auseinanderzusetzen: Passt der Job, so wie er ist, zu mir? Oder könnte ich mich anderswo besser verwirklichen? Einen guten Leitfaden dazu liefert Tom Diesbrock:
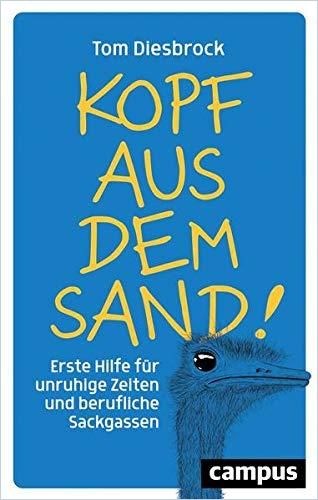
Was aufwändig klingt, hat bei genauerer Betrachtung viele Vorteile: Im besten Fall empfindet der Mitarbeiter sein Jobprofil nach wie vor als stimmig – und ist sich dessen nun bewusst, was ihn womöglich sogar zufriedener macht. Wird ihm aber tatsächlich klar, dass ihn sein Job, wie er jetzt ist, unzufrieden macht, weiß er nach Diesbrocks Analyse gleich auch, woran das liegt – was dem Arbeitgeber konkrete Ansätze zur Verbesserung liefert, so er denn daran interessiert ist.
Kann der Arbeitgeber dem Mitarbeiter das, was dieser sucht, nicht bieten, gibt es zwei Möglichkeiten: Man lässt den Mitarbeiter ziehen – oder man lernt, nicht automatisch davon auszugehen oder sogar zu erwarten, dass jeder Arbeiter intrinsisch motiviert ist. Natürlich, in einer idealen Welt hat jeder genau den Job, für den er brennt. Aber die Realität ist weit davon entfernt. Darauf hinzuweisen, die Arbeitswelt also auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, ja aufzuklären, das ist die Mission von Volker Kitz:

Ihm zufolge haben wir größtenteils unrealistische Ansprüche an unsere Arbeit. Gerade in Anbetracht all der Geschichten über Menschen, die ihre Erfüllung in ihrem Beruf gefunden haben und für die Arbeit keine Arbeit mehr ist, sondern Bestimmung, fühlt man sich in manch grauem Arbeitsalltag im Nachteil – und schaltet innerlich ab. Wir tun also gut daran, Erwerbstätigkeit allgemein nicht so zu romantisieren; etwa nicht nur über Start-ups zu reden, die mit Mut und Leidenschaft die Welt veränderten, sondern darüber, dass auch die Aufgaben von Anwälten oder Ärzten größtenteils Routineaufgaben sind. Und dass es völlig in Ordnung ist, wenn man seinen Job als genau das sieht, was es nun mal ist: ein Job. Dem stimmt auch Unternehmensberaterin Maren Lehky zu.
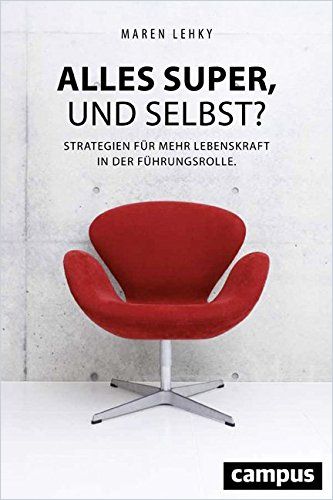
In ihrem Buch Alles super – und selbst? meint sie sogar, dass es erst dieses falsche Bild von beruflicher Erfüllung ist, das uns schließlich am meisten schadet:
Hat man versagt, wenn man einer jungen hippen Beraterin widerspricht, die in einem erfolgreichen Buch postuliert ‚Work is not a job‘? Ist es möglicherweise auch die Überfrachtung von Arbeit mit Lebenssinn, die zur Burn-out-Inflation führt?
Maren Lehky
Egal ob wir uns um mehr Sinnerfüllung oder um mehr Realismus bemühen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muss es möglich sein, sich ihre zeitweise mindere Leistungsfähigkeit ein- und zuzugestehen – ohne Wenn und Aber. Und das ist nicht nur eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung, sondern vielmehr eine dazu, welches gesellschaftliche Verständnis wir von Erwerbstätigkeit haben. Natürlich begrüßen Unternehmen Mitarbeiter, die die Extrameile mit Begeisterung gehen. Mitarbeiter dabei zu unterstützen und Engagement zu fördern, ist auch nicht verwerflich. Doch im Fokus solcher Unterfangen sollte stets das Wohl der Mitarbeiter stehen. Denn wenn Unternehmen die Menschen hinter den Mitarbeitern nicht ernst nehmen, können sie auch nicht erwarten, dass diese es selbst tun.