„Die staatlichen Taschen sind auch nicht unendlich tief“

Herr Beck, viele Menschen machen sich aktuell enorme Sorgen, wie sie ihre Rechnungen angesichts galoppierender Preise künftig bezahlen sollen. Welche Ratschläge haben Sie als Ökonom?
Hanno Beck: Es kommt sicher zuerst einmal darauf an, in welcher Einkommensklasse und in welchem Land der Bürger zu Hause ist. Die Schweiz zum Beispiel ist hier gegenüber der Eurozone in einer klar besseren Position, mit knapp 3 statt fast 9 Prozent Inflation. Das bedeutet zwar nicht, dass Schweizer in niedrigeren Einkommensklassen keine Probleme bekommen können. Aber: Je höher das Einkommen, desto weniger machen einem Preiserhöhungen zu schaffen. Und wenn es, wie in Deutschlands unteren Einkommensklassen, bisher schon knapp war und nun die Preise um 10 Prozent steigen, wird es eng. Deshalb ist verständlich, dass die deutsche Bundesregierung, anders als der Schweizer Bundesrat, Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Leuten unter die Arme zu greifen. Als Ökonom kann ich den Menschen nur raten zu schauen, wo der Sozialstaat sie zusätzlich unterstützen könnte.
Wie nachhaltig sind denn diese Hilfen?
Eine Inflation ist ein systemisches Risiko, das alle betrifft. Es gibt kaum Hintertürchen, durch die Sie vor ihr fliehen können, und deshalb ist es angesichts begrenzter Mittel richtig, dass die Menschen nicht im Regen stehen gelassen werden. Es gibt auch Licht am Horizont: Die aktuelle Inflation wurde sehr stark über die Energiepreise getrieben, und hier deutet sich nun etwas Entspannung an. Viele Experten gehen davon aus, dass die Preise sich zwar auf einem höheren Level einpendeln werden als vor der russischen Invasion und ihren Folgen – aber nicht „unbezahlbar“ bleiben.
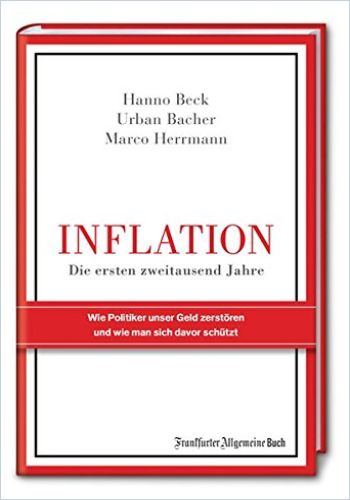
Letztlich hängt das aber auch mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine zusammen.
Genau. Und hier können Sie keine Prognosen treffen, deshalb fliegen wir in Deutschland momentan auf Sicht und versuchen, immerhin die Spitzen abzufedern. Doch Fakt ist: Die staatlichen Taschen sind auch nicht unendlich tief. Und:
Einen zweiten ‚Wumms‘ der Unterstützung können wir uns fiskalisch wohl nicht leisten.
Unsere Partner in der Europäischen Union beäugen unsere „großartigen“ Fiskalpakete der letzten Zeit ohnehin schon misstrauisch. Und das mit Recht.
Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass wir den zweiten „Wumms“ nötig haben werden?
Sagen wir es so: Die höheren Inflationsraten werden uns wohl noch einige Zeit begleiten. Aktuell kann ich dazu aber keine genauere Prognose abgeben, denn die Rahmenbedingungen sind dazu zu unsicher. Wir können zwar extrapolieren, so wie in ruhigeren Zeiten, aber sobald irgendwo eine scharfe Kurve kommt, fliegen wir aus der Bahn. Es gibt dazu ein schönes Bild: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Auto, die Windschutzscheibe ist verdreckt und um den Weg zu bestimmen, schauen Sie in den Rückspiegel. Sie beobachten das, was hinter Ihnen liegt, um das zu prognostizieren, was vor Ihnen liegt. Bei leichten Kurven kann das gutgehen, weil sie die Umgebung im Spiegel lesen können, Krümmungen in der Leitplanke sehen oder Ähnliches. Aber: Ein Stoppschild werden Sie immer übersehen – und auch andere Risiken sind nicht durchs Zurückschauen erkennbar.
Take-aways:
- Höhere Inflationsraten werden uns wohl noch einige Zeit begleiten, deshalb sind Inflationsausgleichsforderungen prinzipiell berechtigt.
- Zuerst stiegen die Vermögenspreise, nun folgen die Güterpreise, weil die Produzenten ihre Kosten (dazu zählen auch höhere Löhne) auf die Endkonsumenten überwälzen.
- Man kann zwischen guten und schlechten Schulden unterscheiden: Schlechte dienen nur dem Konsum, gute Schulden hingegen sind Investitionen, die neuen Wert schaffen.
Aktuell erleben viele Unternehmen, die ähnliche Prognoseprobleme haben wie Sie als Ökonom, dass die Mitarbeitenden einen Inflationsausgleich wollen. Nicht wenige sind damit gerade überfordert.
Eigentlich überraschend, nicht? Es ist doch völlig klar, dass die Arbeitnehmer bei hoher Inflation einen Inflationsausgleich fordern, um ihr Realeinkommen zu erhalten. Je leichter die Arbeitgeber diesen Kostenanstieg auf ihre Preise überwälzen können, desto eher werden sie ihr auch nachkommen. Damit steigt jedoch die Inflation weiter an, weil die Kunden der Firma nun mehr als zuvor zahlen müssen. Und irgendwann schließt sich der Kreis, wenn die Preiserhöhungen in irgendeiner Form auch wieder die nun etwas besser bezahlten Arbeitnehmer erreichen …
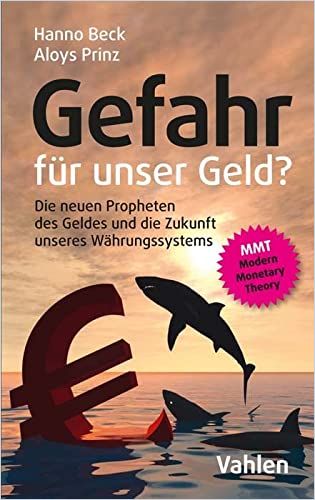
Und wenn die Unternehmen die Preise nicht erhöhen können?
Dann müssen sie entweder sinkende Gewinnmargen hinnehmen, mit der Folge, dass damit unter anderem Investoren abgeschreckt werden, oder sie müssen sparen bzw. produktiver werden – was oft mit Abbau von Personal verbunden ist.
Hinter beiden Entwicklungen steht die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale: Steigende Preise führen zu höheren Lohnforderungen, die zu höheren Löhnen führen, die wiederum höhere Preisen mit sich bringen.
Eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Was treibt die Inflation denn noch?
In den letzten Jahren gab es zwei wesentliche Inflationstreiber: Der erste ist die lockere Geldpolitik der Zentralbanken, die zu einem massiven Geldüberhang geführt hat. Interessanterweise ging das nur, weil man etwa seitens der EZB stets auf die Güterpreise verweisen konnte und sagte: Schaut, wir drucken zwar ständig neues Geld, aber es führt nicht zu Inflation. Ein Blick genügte, und die Leute waren beruhigt. Die Güterpreise sind aber nur die halbe Wahrheit: Richtig ist, dass die Güterpreise nicht gestiegen sind. Die Vermögenspreise – also Aktien, Immobilien etc. – hingegen ganz gewaltig. All das ist deutlich teurer geworden.

Fragen Sie mal die Menschen, die Häuser oder Wohnungen kaufen wollen: Das ist mit einem durchschnittlichen Einkommen in weiten Teilen Deutschlands, vor allem in den attraktiven Ballungsräumen und Zentren, in den letzten Jahren unmöglich geworden. Kurzum: Die lockere Geldpolitik hat zu einer anderen Art von Inflation geführt, die wir bislang in Deutschland so noch nicht kannten. Nun, mit den Nachwirkungen der politischen Reaktionen auf den Ukrainekrieg und dem Preisanstieg für Energie, sehen wir, dass die Inflation auch die Güterpreise in die Höhe getrieben hat – und zwar sehr schnell:
Zuerst stiegen die Energiepreise, darauf dann auch die Erzeugerpreise. Und die werden schlussendlich auf die Endkonsumentenpreise umgelegt.
Da kommt nun noch einiges auf uns zu, auch wenn die Notenbanken nun die Zügel anziehen. Was sich aktuell mit Sicherheit sagen lässt: Für 2023 liegt ein Erreichen der Inflationsziele der EZB noch in weiter Ferne. Und was mit den staatlichen und privaten Schulden passiert, die in den letzten Jahren angehäuft wurden – und nun bedient werden müssen –, haben wir dabei noch gar nicht angesprochen.
Das ist ein gutes Stichwort: Sie trennen in Ihren Büchern zum Thema nach „guten“ und „schlechten“ Schulden. Können Sie an dieser Stelle einen kleinen Crashkurs zum Thema einschieben?
Gern. Bei Schulden kommt es immer darauf an, wer sie macht, wofür sie gemacht werden und wie man damit umgeht. Hier können Sie auch jeden Staats- mit einem Privathaushalt vergleichen. Nehmen wir ein Beispiel: Sie wollen in den Sommerurlaub fahren und nehmen dafür einen Kredit auf. Dann sind das „schlechte“ Schulden, denn nach dem Urlaub ist das Geld weg – und Sie müssen dennoch jeden Cent zurückzahlen. Wenn Sie hingegen einen Kredit aufnehmen, um ein Unternehmen zu gründen, ist das etwas vollkommen anderes, denn die Unternehmensgründung erhöht, wenn Sie sinnvoll wirtschaften, Ihr Einkommen. Und mit dieser Einkommenserhöhung können Sie den Kredit zurückzahlen und haben zudem langfristig eine neue Einnahmequelle erschlossen.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Machen Sie Schulden, um Investitionen zu tätigen, also um Ihre Einnahmen zu erhöhen, sind das gute Schulden. Machen Sie Schulden hingegen nur zum Konsum, geben also nur Geld aus, das dann keinen längerfristigen Mehrwert schafft, sind das eher schlechte Schulden.
Was ist mit den eingangs erwähnten Immobilien?
Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, um ein Haus zu kaufen, heißt das für die Bank: Geht etwas mit der Rückzahlung schief, existiert als Sicherheit immer noch das Haus. Wenn Sie also mit dem Kredit neue Werte schaffen, ist die Verschuldung unproblematisch. Das ist der Grund dafür, dass Sie von der Bank nach vielen berechtigten Fragen – „Was machen Sie mit dem Geld?“ „Wie hoch und umfassend ist Ihr Einkommen?“ „Wie und wann wollen Sie den Kredit zurückzahlen?“ – auch in den aktuell unsicheren Zeiten noch einen Kredit bekommen.
Und die Staatsschulden? Da heißt es doch auch, dass sie zurückgezahlt werden, wenn auch nur langsam und unter neuer Verschuldung unter vielleicht besseren Konditionen.
Auch bei Staatsschulden gibt es die volkswirtschaftlich guten und schlechten: Schulden, die aufgenommen werden, um damit Infrastruktur zu bauen oder Investitionen zu tätigen, die das Wachstum steigern, führen zu mehr Wohlstand und zu mehr Steuereinnahmen – das ist für alle eine gute Sache. Aber wenn es um Kredite geht, die den Staatskonsum bezahlen, sieht es anders aus. Wachsende Sozialausgaben zum Beispiel sind keine Investitionen ins Wachstum einer Volkswirtschaft. Verstehen Sie das nicht falsch: Jeder Staat soll Sozialausgaben tätigen, wenn sie nötig sind, aber sie steigern nicht die Fähigkeit, die Schulden auch zurückzuzahlen. Deshalb sollten Sozialausgaben auch eher aus dem gegenwärtigen Sozialprodukt finanziert werden und nicht durch Verschuldung, damit die Risiken im Zaum bleiben.
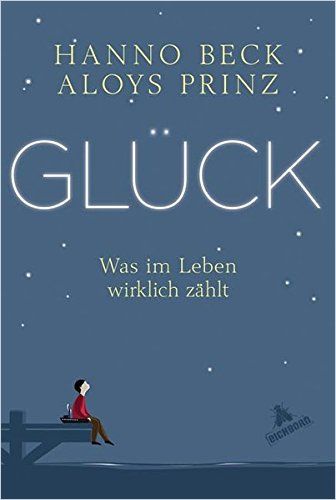
Verraten Sie uns zum Abschluss noch, wie Sie privat – aber natürlich als Ökonom, der sich schon lange mit diesen Themen beschäftigt – mit der aktuellen Unsicherheit umgehen?
Als gebürtiger Rheinhesse bereite ich mich aufs Schlechteste vor, während ich aufs Beste hoffe. (Lacht.) Ich bin gelassen optimistisch, weil ich weiß: Viele Dinge können wir persönlich nicht beeinflussen. Und dann bringt es nichts, sich von ihnen verrückt machen zu lassen. Wenn ich trotzdem hin und wieder einen Blick auf den Stand der Gasspeicher in Deutschland werfe, muss ich meist über mich selbst lachen.
Über den Autor
Hanno Beck ist Professor für VWL und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Pforzheim, zuvor war er Wirtschaftsredakteur der FAZ. Zudem ist er Autor verschiedener Bücher wie Glück, Abgebrannt und Geld denkt nicht.










