„Viele Frauen sind hart im Nehmen. Aber: Warum müssen sie es sein?“

getAbstract: Frau Hucke, in Fair führen öffnen Sie so mancher Führungskraft die Augen für eigene Unzulänglichkeiten im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben für große Unternehmen wie HP und Philips in Top-Positionen gearbeitet – haben Sie selbst schon die Erfahrung gemacht, nicht fair geführt zu haben?
Veronika Hucke: Ich muss leider zugeben, dass ich in vielen Situationen zu wenig fair war. Ich bin schnell aufgestiegen, hatte mit 28 die erste Führungsrolle. Wenn es ab da irgendein Projekt zur Frauenförderung gab, wurde ich zwangsrekrutiert. Lange Zeit habe ich das gehasst. Ich war überzeugt: Wer wirklich will, kann es auch nach oben schaffen. Und: Wem das nicht gelingt, wäre nicht klug, talentiert oder entschlossen genug. Rückblickend war das natürlich unfassbar arrogant. Zu meiner „Verteidigung“ kann ich sagen, dass das Bewusstsein in den 90ern auch noch ein anderes war.
Was hat sich geändert?
Zu Anfang meiner Karriere ging es bei den sogenannten „Frauenförderungsmaßnahmen“ darum, Frauen zu vermitteln, wie sie sich in einer Männerwelt behaupten. Wer heute mit halbwegs offenen Augen durch die Welt geht, hört aber von der Bedeutung von Privilegien, den Aspekten in der eigenen Biographie, die einem den Aufstieg erleichtern. Meine Eltern waren zum Beispiel beide Akademiker. Sie hatten immer Vertrauen zu mir und in meine Fähigkeiten, selbst als meine Zeugnisse dazu wenig Anlass gaben. Ich bin als Kind in den USA in die Schule gegangen, habe in England studiert. Ich bin selbstbewusst, extrovertiert, neugierig und schwer zu erschrecken. All das hilft bei der Karriere, wenn es darum geht, gesehen und wahrgenommen zu werden. Heute sind wir weiter und in guten Unternehmen liegt der Fokus darauf, Barrieren für Diversität abzubauen, Systeme und Prozesse zu hinterfragen und gerechter zu gestalten. Daraus ist der Impuls für das Buch entstanden.
Wie sehen diese Anstrengungen der Unternehmen heute aus – und was taugen sie?
Viele Unternehmen haben zum Beispiel „Unconscious Bias Trainings“ im Programm. Teilnehmende lernen hier, wie unbewusste Vorurteile unser Urteil trüben und unser Verhalten beeinflussen. Dass unsere Entscheidungen längst nicht so rational sind, wie wir das gerne glauben. Und die meisten, die an einem solchen Training teilnehmen, finden es wirklich spannend. Das Problem: Oft wissen sie anschließend zwar, dass sie öfter mal ungerecht sind und falsch urteilen, aber nicht, wie sie es verhindern sollen.
Bei unbewussten Vorurteilen handelt es sich um Assoziationen, die so fest etabliert sind, dass sie ohne Bewusstsein, ohne Absicht und ohne Kontrolle funktionieren. Der beliebte Rat, man solle sie sich „bewusst machen“, reicht da einfach nicht aus.
Veronika Hucke
Das ist ein Feedback, das ich auch ganz oft von Führungskräften bekomme: Sie haben an einem Training teilgenommen, sie waren fasziniert oder erschreckt, sie haben eventuell auch einige ihrer unbewussten Vorurteile erkannt, aber wissen nicht, wie sie verhindern sollen, dass diese „zuschlagen“. Wie sie ein gerechteres Urteil fällen können. Wie sie sich besser und fairer verhalten sollen. Hier will ich mit „Fair führen“ Hilfestellung geben. Typische Situationen beschreiben, die alle aus dem Unternehmensalltag und dem täglichen Leben kennen, erklären, was abläuft und was die Wissenschaft dazu sagt und ganz praktische Tipps vermitteln, um besser zu reagieren.
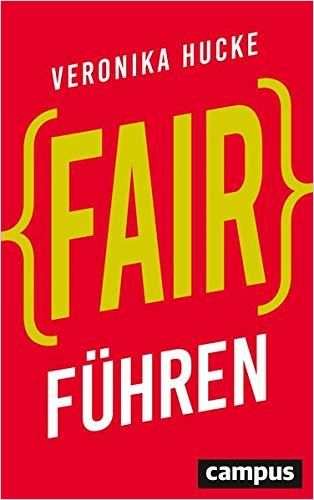
Führungskräfte, so schreiben Sie, müssen fair sein, das heißt: anständig, gerecht und ehrlich. Klappern wir die Begriffe kurz gemeinsam ab. Beginnen wir mit dem Anstand. Das Wort klingt ein wenig antiquiert, steht aber hoch im Kurs. Wo hört der Common Sense zum Anstand auf?
Ein typischer Fall sind Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage, bei denen Stellen abgebaut werden. Wenn es fair – oder anständig – zugeht, wird sowas auf Basis schlüssiger Kriterien entschieden, die für alle gelten. Es bleiben dann die, deren Qualifikationen besonders wichtig sind, die gute Leistung bringen. Und natürlich gilt es, soziale Aspekte zu berücksichtigen. Trotzdem laufen solche Fälle oft anders ab.
Unfair wird es, wenn im Endeffekt die Sympathie entscheidet.
Veronika Hucke
Wenn ich die „richtigen“ Menschen kennen muss, um meinen Job zu behalten oder eine andere Position zu finden. Das ist übrigens nicht nur unfair den Betroffenen gegenüber, es ist auch nicht gut fürs Unternehmen.
Sie schreiben, dass „fair führen“ bedeutet, alle gleich – also gerecht – zu behandeln. Aber Hand aufs Herz: Ist das überhaupt möglich? Mir fällt es schon schwer, im Privatleben „gerecht“ zu sein, etwa im Hinblick auf das Jonglieren zwischen Beruf und Familie, ganz zu schweigen von den eigenen Familienmitgliedern… nicht zuletzt den Kindern. Das gelingt oft nicht. Und dieser Umstand frustriert doch.
Dass „fair sein“ bedeutet, alle gleich zu behandeln, ist ein Missverständnis. Ganz im Gegenteil: Fair zu führen heißt, das Umfeld und das eigene Verhalten an die Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen anzupassen. Nur so ist es möglich, gleiche Voraussetzungen zu schaffen und Barrieren abzubauen, die die Karriere blockieren können. Perfektion ist dabei zugegebenermaßen kaum zu erreichen. Wenn ich mich allerdings bemühe, unterschiedlichen Menschen gerecht zu werden, zu verstehen, was sie umtreibt, warum sie agieren, wie sie es tun und was mein eigenes Verhalten beeinflusst, dann ist damit schon eine Menge gewonnen. Wenn ich dazu noch zeige, dass ich mich bemühe, aber auch weiß, dass ich zuweilen daneben liege, dass mir deshalb Rückmeldungen wichtig sind und ich sie ernst nehme, dann bekomme ich die Hilfestellung, die ich brauche, um immer besser zu werden.
Welche zusätzlichen Hürden für Gerechtigkeit – jenseits der von Ihnen im Buch erwähnten bewussten oder unbewussten Diskriminierungen, dazu kommen wir noch – existieren exklusiv im Geschäftsleben? Ich denke hier vor allem an Hierarchiestufen, verschiedene Bekanntheitsgrade im Umgang untereinander usw.
Ein großes Problem, gerade für Führungskräfte, ist Betriebsblindheit. Und die wird von Ebene zu Ebene tendenziell schlimmer.
Häufig schrecken Beschäftigte davor zurück, Überbringer negativer Botschaften zu sein. Deshalb erwähnen viele vorzugsweise die positiven Nachrichten, sprechen über Erfolge und reden Probleme eher klein. Mit der Zeit entsteht dann eine himmelblaue Blase, in der die Welt in Ordnung ist.
Veronika Hucke
Spätestens dann traut sich keiner mehr, mit der unverblümten Wahrheit beim Chef um die Ecke zu kommen. Sehr sichtbar wird das dann, wenn die Situation eskaliert und ein handfester Wirtschaftsskandal entstanden ist. Auch in der Politik kommt so etwas zunehmend vor.
Was begünstigt denn solche Katastrophenspiralen?
Besonders leicht entstehen solche Luftschlösser, wenn sich Menschen mit anderen umgeben, die ihnen ähnlich sind. Das gleiche Geschlecht, eine ähnliche Sozialisierung, vergleichbare Erfahrungen. Eine solche Konstellation schafft den Nährboden für das sogenannte „Gruppendenken“. Es bedeutet, dass abweichende Meinungen und konträre Ideen von den Beteiligten nicht ausgesprochen werden. Selbst wenn sie mit Aussagen und Entscheidungen nicht einverstanden sind, lassen sie diese unkommentiert, um die Harmonie und den Zusammenhalt nicht zu stören. Spannend finde ich in dem Kontext auch eine Untersuchung, die illustriert, wie gefährlich blindes Vertrauen sein kann – und dass auch das in homogenen Gruppen besonders leicht entsteht. Die Wissenschaft hat zum Beispiel verschiedentlich festgestellt, dass Voraussagen zur Preisentwicklung von Investment-Teams sehr viel schlechter waren, wenn sie ausschließlich aus weißen Menschen bestanden. Der Grund: Die Weißen haben überhöhte Preise ihrer weißen Kollegen ungefragt übernommen. In „bunten“ Teams wurden die Einschätzungen der Kolleginnen und Kollegen hinterfragt und ggf. korrigiert – und dadurch Preisblasen verhindert.
Spannend sind in diesem Zusammenhang auch Ihre Ausführungen zu Geschlechterfragen, damit verbundenem Gruppendenken und zur Netzwerkbildung: Es gibt sie zum Beispiel zwar noch, die allzu bekannten „Boys Clubs“, aber sie werden weniger. Nicht zuletzt, weil die Küngelei der Innovationskraft, also dem eigenen Wachstum schadet. Welche Erfahrungen haben Sie mit derartigen Netzwerken gemacht?
Ich habe es immer wieder erlebt, dass es schwierig für mich war, Zugang zu einem Boys Club zu bekommen, zu einem Zirkel, bei dem mir die Mitglieder – oft sogar unbewusst und ungewollt – vermittelt haben, dass ich nicht dazugehöre. Das kann daran liegen, dass sie gemeinsame Erlebnisse in epischer Breite und mit gleichbleibender Begeisterung Revue passieren lassen und mir damit klar vermitteln, dass wir niemals ein vergleichbares Maß an Vertrautheit erreichen werden. Dass Termine zu Zeiten stattfinden, die nicht für alle machbar sind oder Diskussionen auf dem Herrenklo fortgeführt werden.
Heute wundere ich mich selbst über eine Situation, in der ich mit den Kollegen in einen Stripclub gegangen bin und sie unbedingt wollten, dass ich einen Lap-Dance bekomme. Ich fand die Situation fürchterlich, die anderen unheimlich witzig.
Veronika Hucke
Weil ich mich nicht blamieren und die gute Beziehung zu den Kollegen nicht gefährden wollte, habe ich eine gute Miene dazu gemacht. Und leider sind die Zeiten nicht vorbei: Eine junge Frau hat mir gerade berichtet, dass sie bei einer Feier im Büro gebeten wurde, die Geburtstagstorte zu überreichen. „Jetzt musst Du auch die Kerzen ausblasen“, sagte einer zum Geburtstagskind. Sein „Fürs Blasen bin hier doch nicht ich zuständig“, wurde von den Männern mit einem begeisterten „Blasen, Blasen“-Chor aufgenommen. Was mich dabei am meisten stört, ist nicht die einzelne Situation. Es ist die Reaktion, die man häufig erlebt – von Männern ebenso wie von Frauen. Da ist keine Einsicht. Sowas wie „Stimmt. Das war nicht gut, kommt nicht wieder vor.“ Stattdessen hört man „War doch nicht so gemeint“, „Stell Dich nicht so an“ oder „Da kannst Du doch drüberstehen“. Meiner Erfahrung nach sind ganz viele Frauen hart im Nehmen. Aber die Frage bleibt doch: Warum müssen sie es sein?
Um ein Netzwerk oder Unternehmen gezielt vielfältiger zu machen, schlagen Sie vor, sich strategische Ziele zu setzen und dann aktiv nach Kontakten zu suchen, die – jenseits der Komfortzone – beim Erreichen dieser Ziele helfen können. Klingt einleuchtend für Großunternehmen. Was machen aber hier Familienunternehmen und KMUs, deren Führungsetagen aus guten Freunden oder gar Verwandten bestehen?
Grundsätzlich hilft es, die Sache strukturiert anzugehen. Sich zu überlegen, welche Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten für den Geschäftserfolg erforderlich sind und dabei besonders darauf zu achten, welche neuen Anforderungen durch Veränderungen im Markt entstehen, oder das Geschäftsmodell beeinflussen. Auf der Basis kann ich dann überprüfen, wie gut ich für die Zukunft aufgestellt bin, bzw. welche Schwachstellen existieren. Gerade erfolgreiche Familienunternehmen und KMUs sind erfahrungsgemäß gut darin, an eine erfolgreiche Vergangenheit anzuknüpfen.

Der getAbstract International Book Award wird seit 2001 jährlich an Titel vergeben, die aktuelle wirtschafts- und businessrelevante Themen auf außergewöhnliche Weise in den Mittelpunkt rücken. In diesem Jubiläumsjahr wird der Preis symbolisch durch eine Reihe von Interviews und Online-Events verliehen. Mehr Informationen finden Sie hier.
Kommen wir zur Ehrlichkeit. Auch das ist ein großes Wort. Nicht wenige Unternehmensformen und Geschäftsfelder setzen einen sehr hohen Grad an Diskretion voraus – und nicht jede Information ist für alle Teammitglieder bestimmt. Auf Nachfrage kommt dann so mancher ins Schwitzen, erzählt abwiegelnde Halbwahrheiten oder schlicht: eine Notlüge. Welchen Gradmesser für Ehrlichkeit gibt es im Geschäftsleben?
Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass ich allen alles erzählen muss. Aber: Das, was ich sage, sollte der Wahrheit entsprechen. Das heißt gegebenenfalls auch: „Ich kann dazu aktuell nichts sagen“. Auch hier ist es allerdings wichtig, nach gleichen Standards vorzugehen. Um Aktionäre zu schützen, gibt es deshalb bei wichtigen Neuigkeiten eine Pflicht zu Ad-Hoc-Mitteilungen, aber innerhalb von Teams sieht das ganz anders aus. Da hängt der Zugang zu Informationen oft davon ab, wie gut ich mit dem Chef oder der Chefin auskomme oder mit denjenigen, die immer am allerbesten über das Geschehen in der Firma informiert sind. Gerade im Falle von größeren Veränderungen gibt das einigen einen unfairen Vorteil: Weil sie sich besonders schnell in vielversprechende Richtungen neu orientieren können oder den Eindruck hinterlassen, besonders souverän mit der neuen Situation umzugehen. Das ist nicht nur schlecht für die anderen. Auch dem Unternehmen gehen oft wichtige Perspektiven – und potenziell tolle Beschäftigte – verloren.
Welchen Einfluss hat hier die Sprache? Ich meine: Wenn Sie zu allen gleich ehrlich sein wollen – befördert das nicht am Schluss auch den Floskel-Diskurs, bekannt aus den öffentlichen Meldungen der PR-Abteilung, in dem sich alle nur durch möglichst harmloses und nach allen Seiten offenes Reden gegeneinander absichern, um nur ja nichts „Falsches“ zu sagen?
Floskeln helfen niemandem weiter und schließen sich in einer ehrlichen Kommunikation fast aus. Wenn ich einem Menschen gegenüber ehrlich bin, ist das ein Zeichen von Wertschätzung – oder sollte es zumindest sein. Ich habe ein Interesse an meinem Gegenüber und eine Information, die für ihn oder sie wichtig ist. Deshalb sollte ich mich auch darum bemühen, sie so zu vermitteln, dass sie ankommt. Das kann Mühe und Vorbereitung kosten, gerade wenn ich mit diesem Menschen wenig gemeinsam habe. Wer sich deshalb aber davor drückt oder sich darauf beschränkt „jetzt mal brutal ehrlich zu sein“, macht es sich zu leicht.
Diskriminierungen im Arbeitsleben untergraben die Teamleistung, indem sie für unnötige Reibung und Frust sorgen, schreiben Sie. Und Ihr Buch erklärt das wunderbar anschaulich. Gibt es dazu eigentlich aktuellere, orientierende Zahlen und Studien, die klar machen, wie groß das Ausmaß wirklich ist?
Das World Economic Forum hat letzthin seinen Gender Gap Report für 2020 veröffentlicht. Er zeigt, dass zum Beispiel die DACH-Länder von einer gleichberechtigten wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen weit entfernt sind. Auch im internationalen Vergleich stehen alle drei Länder nicht so gut da, wie man sich das wünschen würde: Die Schweiz liegt auf dem 34. Platz, Deutschland auf Platz 48 und Österreich sogar nur auf 86. Da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Hat sich das Problem und auch das Problembewusstsein in den letzten Jahrzehnten und Jahren strukturell verändert?
Ja. Immer mehr Menschen bringen „erworbene Vielfalt“ mit, sammeln im Laufe ihres Lebens Erfahrungen, die ihnen neue Perspektiven eröffnen und einen anderen Blick auf die Welt und ihre Mitmenschen ermöglichen. Gerade jüngere Menschen mit einem internationalen Bekanntenkreis gewinnen Einblicke in ganz unterschiedliche Wertesysteme und Lebensmodelle. Das schärft gleichzeitig den Blick für Barrieren, die sich anderen in den Weg stellen. Bewusstsein allein reicht allerdings nicht, um Veränderungen zu erzielen. Das sieht man sehr gut auf der Führungsebene.
An der Spitze von deutschen Unternehmen heißen tendenziell noch immer mehr Menschen Thomas oder Stefan, als insgesamt Frauen vorhanden sind.
Veronika Hucke
Die soziale Mobilität nimmt sogar ab. In Deutschland werden 42 Prozent der Kinder, deren Väter Geringverdiener sind, ebenfalls Geringverdiener – deutlich mehr als im OECD-Durchschnitt.
Welchen Einfluss hat das seit einigen Monaten deutlich weiter verbreitete „Remote Working“ auf die Problemlage?
Wenn sich Menschen nicht regelmäßig persönlich begegnen, verstärkt das tendenziell bestehende Herausforderungen. Ich habe letztes Jahr – vor Corona – mit einer Kollegin eine große Online-Befragung zu verteilt arbeitenden Teams gemacht. Einige der Ergebnisse wurden inzwischen komplett von der Realität überholt. Die Möglichkeit, gelegentlich von zu Hause zu arbeiten, war damals in vielen Firmen ein Recht, dass man sich verdienen musste. Eine Option, die nur nach langjähriger Firmenzusammengehörigkeit und bei einer guten Beziehung zu den Vorgesetzten bestand. Das hat sich erledigt. Was an Relevanz gewonnen hat:
Wir haben festgestellt, dass gerade für diejenigen, die häufig oder immer getrennt von ihrem Team sitzen, die Beziehung zum Vorgesetzten einen besonders hohen Stellenwert hat. Dass sie ganz entscheidend dafür ist, wie zufrieden Menschen mit ihrem Job sind und dafür, wie gut sie ihn erledigen können.
Veronika Hucke
Diejenigen, die angegeben haben, keine gute Verbindung zum Chef oder der Chefin zu haben, haben zum Beispiel mehr als fünfmal häufiger angegeben, dass ihnen wichtige Informationen fehlen. Mit Corona wird also die Chefrolle noch einmal zentraler. Sie erfordert aufgrund der räumlichen Distanz mehr Aufmerksamkeit und tendenziell auch andere Instrumente.
Sie schreiben auch, dass Fairness schon beim Recruiting beginnt. Hier sind die Stereotypen besonders allgegenwärtig: Viele Recruiter trauen jemandem, der Murat heißt, nicht so viel Bildung zu wie einem Max. Und einer Mandy nicht so viel wie einer Charlotte. In den USA haben Fans von Countrymusik – im Gegensatz zu Klassikfans – kaum Chancen auf ein Bewerbungsgespräch. Mit welchem Mittel, welchem Kniff lässt sich hier gegensteuern?
Um verschiedene Menschen objektiv zu beurteilen, ist Struktur erforderlich – je mehr, desto besser. Grundsätzlich ist zunächst entscheidend, sich über die wichtigsten Anforderungen einer Position klar zu werden. Worum geht es in dem Job, was muss jemand mitbringen, um erfolgreich zu sein? Wie lassen sich diese Fähigkeiten und Erfahrungen am besten erheben? Was für Möglichkeiten gibt es, die tagtägliche Arbeit möglichst gut im Auswahlprozess abzubilden? Wie könnten Arbeitsproben aussehen, was für Aufgaben lassen sich stellen, um die Prognosequalität zu erhöhen?
Sie meinen einen einheitlichen Anforderungs- und Fragenkatalog?
Ja. Ein einheitlicher Fragenkatalog stellt zumindest sicher, dass grundsätzlich die gleichen Informationen erhoben werden. Wenn bestimmte Aspekte wichtiger sind als andere, sollten im Vorfeld Punkte vergeben werden, die die relative Bedeutung reflektieren. Selbst wenn es den Gesprächsfluss stört, ist es wichtig, die Fragen im Interview dann in der gleichen Reihenfolge zu stellen, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen. Zudem sollten die einzelnen Antworten sofort bewertet werden. Damit wird verhindert, dass einzelne brillante Aussagen ein zu hohes Gewicht erhalten und Defizite überdecken. Wenn es dann ans Vergleichen geht, sollte die Beurteilung Frage für Frage erfolgen, statt auf Basis des Gesamtbilds. Auch das erhöht die Objektivität und verhindert, dass man von der eigenen Begeisterung davongetragen wird. Gleichzeitig ist man weniger anfällig dafür, dass Stereotype das Urteil beeinflussen, wenn verschiedene Menschen parallel beurteilt werden.
Wie steht es um die Diversität auf der HR-Seite? Hilft es, wenn bei Bewerbungsgesprächen eben nicht nur drei weiße, männliche Heteros zwischen 40 und 50 die Fragen stellen?
Das ist definitiv hilfreich, aber selbst dann lohnt es sich, ein paar Tipps zu beherzigen. Zum Beispiel sollten Interviews grundsätzlich einzeln geführt werden, statt die Bewerbenden gemeinsam zu befragen. Das erleichtert oft nicht nur die Terminfindung. Es verhindert auch, dass Gruppendenken den Verlauf des Gesprächs oder die Bewertung beeinflusst. Bevor die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten dann diskutiert werden, sollten alle “Einzelnoten“ konsolidiert werden. Auch das stellt sicher, das keine wichtigen Informationen aufgrund der Gruppendynamik verloren gehen.
Abschlussfrage: Wenn klar ist, dass eine Führungskraft aktiv diskriminiert, und zwar bei vollem Bewusstsein: Wie sollten die Betroffenen und ihre Kolleginnen und Kollegen dagegen vorgehen?
Sich Hilfe suchen. Bei der Personalabteilung, beim nächsthöheren Vorgesetzen, dem Betriebsrat oder bei einer Ethik-Hotline, wie sie in vielen größeren Unternehmen existiert.
Wer betroffen ist, sollte Vorfälle erfassen: Was ist passiert? Wie war die Situation? Aber auch: Warum fühlen Sie sich verletzt und diskriminiert? Selbst Situationen, die ähnlich wirken, sind nämlich nicht unbedingt gleich.
Veronika Hucke
Ich habe lange Zeit in einem Team mit vielen Frauen gearbeitet und hatte zwei Chefs, die von uns als „Mädels“ sprachen. Bei einem tropfte daraus Herablassung und es diente klar dazu, uns auf unseren Platz zu verweisen. Der andere kam irgendwann erschreckt und beichtete, er habe bemerkt, dass er im Kollegenkreis von uns als „seinen Mädels“ spricht und er wolle es ganz gewiss nicht wieder tun. Allerdings war sein Stolz auf unsere Leistung unmittelbar greifbar – auch für seine Kollegen. Wer von einer Beschwerde hört, sollte sie unbedingt ernst nehmen. Wirklich zuhören. Die Erfahrungen nicht kleinreden, sondern Empathie zeigen und sich um echtes Verständnis bemühen. Um dann gemeinschaftlich daran zu arbeiten, eine Lösung zu finden.
Über die Autorin
Veronika Hucke war fast 20 Jahre in Führungspositionen für Kommunikation und Markenführung bekannter Unternehmen verantwortlich. Zuletzt in der zentralen Personalabteilung von Philips in Amsterdam. Heute unterstützt sie als Beraterin verschiedene Dax-Konzerne sowie die UNO in Fragen zu Diversity und Inklusion. Zuletzt von ihr erschienen: Fair Führen (Campus).







