„Je weniger wir das Ziel haben, zu überzeugen, desto überzeugender sind wir.“

Frau Braun, wenn man nur den Titel Ihres Buchs betrachtet, könnte man meinen, es ginge womöglich auch darum, Menschen dazu zu bringen „meiner Meinung zu sein“. Ihnen ist, wie man dann am Untertitel – und im gesamten Rest des Buchs – sieht, aber Kooperation das eigentliche Anliegen, richtig?
Marie-Theres Braun: Diese Frage habe ich mit meiner Lektorin gleich am Anfang unserer Zusammenarbeit diskutiert. Denn der Titel und die Beschreibung des Buchs zielen ja darauf ab, wie man Besserwisser überzeugen kann. Meine Idee ist aber nicht, dass alle, die anderer Meinung sind, einfach stur sind. Dennoch habe ich mich überzeugen lassen – was man absolut darf und sollte, sonst gäbe es ja nur Besserwisser –, weil ich mir gedacht habe, dass man mit dem Titel und diesem Cover auch die Leute erreicht, die selbst gern Recht haben wollen – und sie sind es, die das Buch lesen sollen, aber aus dem Grund, in eine Selbstreflexion zu kommen: Es geht eben nicht darum, dass wir immer auf der richtigen Seite stehen. Es geht darum, kooperativ zu sein.
Was heißt denn Kooperation im Rahmen von Überzeugungsarbeit?
Manche glauben, kooperativ zu sein, bedeutet, sehr weich zu sein, immer Verständnis für alles zu haben. Dem ist aber nicht so.
Kooperation bedeutet, dass ich bereit bin, mit der anderen Person ins Gespräch zu gehen und ein Gespräch auch konstruktiv positiv zu beeinflussen.
Und dazu kann durchaus auch Konfrontation gehören. Das ist nicht das Gegenteil, sondern ein Teil von Kooperation.
Zumal wir alle Momente haben, in denen wir stur und defensiv werden, oder?
Definitiv. Und zwar immer wenn es um Themen geht, die uns wichtig sind, mit denen wir uns schon lange befasst haben: die berühmten Wertethemen. Natürlich denken wir da, dass wir auf der richtigen Seite sind. Und manchmal sind wir das ja auch. Ich gehöre nicht zu den Trainerinnen, die sagen: „Alle Perspektiven sind richtig.“ Wichtig ist nur, sich bewusst zu sein, dass es nicht immer nur die anderen sind. Eine wichtige Zielgruppe sind daher auch die Menschen, die glauben, dass sie Recht haben. Und die dann lesen, was es mit anderen Menschen macht, wenn man sich entsprechend verhält. Denn manchmal bringen wir andere erst durch unsere Aussagen dazu, dass sie Recht behalten wollen.
Menschen definieren sich heute sehr stark über ihre Werte und Ansichten. Glauben Sie, dass wir in der Folge auch am Arbeitsplatz immer häufiger mit den genannten Wertethemen und -diskussionen konfrontiert sein werden?
Das glaube ich schon, auch weil wir gesellschaftlich eine Werteverschiebung haben. Noch bis vor Kurzem war eine Kultur vorherrschend, in der ein starker Pragmatismus herrschte, Sachlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Emotionen hatten wenig Platz. Man musste nicht auf jede Person Rücksicht nehmen. Diese Werte verschieben sich hin zu mehr Sensibilität auf verschiedenen Ebenen. Sensibilität den Menschen gegenüber, die repräsentiert werden sollen, in der Sprache zum Beispiel. Sensibilität, was unser Klima angeht, unsere Umwelt angeht. Deshalb findet auch eine Verschiebung in Unternehmen statt. Der Mensch wird immer mehr gesehen. Es stellen sich Fragen wie: Wie können wir auf unterschiedliche Bedürfnisse und Charaktere mehr Rücksicht nehmen? Wie drücken sich unterschiedliche Menschen aus?
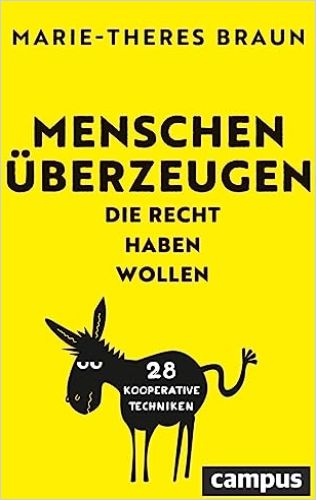
Und was bedeutet das für die Unternehmen?
Es wird notwendig, eine positive Diskussionskultur und Gesprächskultur zu etablieren. Denn man wünscht sich ja Teamwork. Man will unterschiedliche Charaktere in Unternehmen haben. Was aber oft nicht gesehen wird, ist, dass das automatisch Konflikte und Emotionen mit sich bringt, wenn unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten. Und da sind natürlich Gesprächskompetenzen gefragt.
Was können denn Unternehmen selbst oder Führungskräfte tun, um eine positive Gesprächs- und Konfliktkultur zu etablieren?
Mehr persönliche Gespräche führen. Viele sind zu sehr im operativen Bereich, als dass sie ihre Mitarbeitenden wirklich durch Kommunikation führen können, sie haben keine Zeit dafür. Und manche machen die Kommunikation rein schriftlich und dadurch kann man nicht so gut Vertrauen aufbauen. In das Schriftliche kann nämlich viel hineininterpretiert werden, weil die Körpersprache und die Stimme fehlen. Dann tendieren Menschen dazu, in dieses Kommunikationsvakuum eher Schlechtes hineinzuinterpretieren. Auch sollte man in Unternehmen das Signal senden, dass Konflikte normal sind, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und es darf nicht so sein, dass ein Unternehmen möchte, dass nie Konflikte stattfinden oder dass man darüber nicht reden will. Auch die Führungskräfte sollten dafür Verantwortung übernehmen.
Konflikte sind auch Chefsache bzw. Chefinnensache. Ein reines ‚Klärt das unter euch‘ ist die falsche Einstellung.
Die positive Gesprächskultur wird ja gern als Wert definiert. Aber bringt so ein Wert überhaupt etwas?
Wenn er nicht definiert ist, nicht. Viele Unternehmen wissen gar nicht, was sie unter einer „positiven Gesprächskultur“ konkret verstehen. Es könnte bedeuten, dass jede Perspektive im Meeting erst mal angehört wird, ohne dass Kritik geäußert wird. Oder dass Menschen ausreden dürfen, aber Vielredner unterbrochen werden. Dass Emotionen und leidenschaftliches Diskutieren erlaubt sind. Diese Werte definiert und konkretisiert man idealerweise in gemeinsamen Workshops mit Mitarbeitenden. Denn Mitarbeitende wollen Mitbestimmungsrecht haben. Das sind übrigens keine Soft Skills. Das sind Hard Skills. Das ist die Grundlage für hervorragende Arbeitsergebnisse. Sonst gewinnt immer nur die schnellste Lösung im Meeting, weil ganz wichtige Stimmen überhaupt nicht gehört wurden. Nämlich die von denjenigen, die mittlerweile gar keine Lust auf Diskussion haben.
Es soll nicht die Idee des Lautesten am Ende gewinnen, sondern die beste Idee, die ausdiskutiert wurde. Und das geht nur, wenn alle diskutieren können.
Das könnte auch gleich eine allgemeine Regel sein für alle Entscheidungen und Gespräche, egal ob beruflich der privat …
Grundsätzlich sollte man sich immer vor Augen halten:
Menschen wollen nicht überzeugt werden – sie wollen nach ihrer Meinung gefragt werden.
Churchill soll mal gesagt haben: „Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, dann ist einer von ihnen überflüssig.“ Wir sollen also keine Angst haben vor anderen Meinungen. Wir sehen direkt vor der Haustür, wie wertvoll Demokratie ist. Und deswegen sollten wir alle daran arbeiten, dass wir demokratisch sind. Und das bedeutet sowohl, anderen Menschen zuzuhören, als auch anderen Menschen etwas entgegenzusetzen. Wir sollten miteinander reden – gerade dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Eine weitere Zielgruppe meines Buches sind deshalb diejenigen, die über andere sagen: „Mit der Person kann man nicht reden.“
Wie versuchen Sie, sie vom Gegenteil zu „überzeugen“?
Indem ich viele so eingängige Beispiele wie das von Daryl Davis erwähne, einem Afroamerikaner, der allein durch Gespräche führende Mitglieder des Ku-Klux-Klans dazu brachte, auszusteigen. Denn: Wir geben tendenziell zu früh auf. Wenn man das Gefühl hat, mit einer Person könne man nicht reden, sollte man sich fragen: Wie oft habe ich es denn wirklich versucht? Und auf welche Weise? Mit welchem Anspruch? Abgesehen davon richtet sich das Buch auch an die sehr harmoniebedürftigen Menschen, die in dem Buch sehen sollen, dass sie ganz viel in sich tragen, was wertvoll ist für Überzeugung, ohne dass sie in die Härte gehen müssen.
Sie glauben also, dass sich „mit allen“ reden lässt?
Ich würde es anders formulieren:
Ich finde es notwendig, im Gespräch zu bleiben, denn wir können nur etwas bewegen, wenn wir miteinander reden. Geben wir zu früh auf, verlieren wir unsere Gesprächskompetenzen.
Wir schaffen es nicht mehr, mit Leuten zu reden, die anderer Meinung sind, weil wir aus der Übung kommen, weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind. Wir werden kritikunfähig und wir verlieren wertvolle Beziehungen. Und deswegen denke ich, ist es „immer gut“, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Sie haben vorhin gesagt, Kooperation sei auch Konfrontation. Wann ist es sinnvoll, konfrontativ zu sein, um eine Kooperation zu erzeugen?
Wenn ich mich selbst wieder auf eine Augenhöhe mit dem Gegenüber bringen möchte. Dazu kann man sich auch fragen: Was ist mein typisches Kommunikationsmuster? Gehöre ich eher zu denen, die viel zu forsch sind und denken, man müsse klare Kante zeigen? Oder gehöre ich zu denen, die sehr zurückhaltend sind und so verständnisvoll, dass sie ihren eigenen Standpunkt schnell verlieren – und dann vom Gegenüber nicht ernst genommen werden? Anschließend kann man sich fragen, wo die eigene Entwicklung hingehen könnte. Denn man kann durchaus verständnisvoll sein, immer noch respektvoll zum Gegenüber, aber eben hart in der Sache. Dabei verzichte ich auf Belehrungen und Moralisierungen – aber zeige glasklar, wo meine Grenze ist.
Was denken Sie, weswegen versuchen viele Leute, auf eine falsche Weise zu überzeugen?
Am ehesten passiert das, weil wir im Stress in extreme Kommunikationsmuster fallen, die ich eben bereits erwähnt habe. Wir werden entweder viel zu forsch und moralisierend, dämonisieren und stecken andere in Schubladen. Oder wir sind viel zu verständnisvoll und geradezu konfliktscheu. Mit diesen typischen Kommunikationsmustern kommt man nicht weiter. Und daraus schließen wir dann, dass keine Kommunikation möglich ist. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir in solchen Situationen emotional so drinstecken, sondern auch daran, dass wir viele falsche Vorbilder haben.
Zum Beispiel?
Wir sehen ständig Leute in Talkshows, auf YouTube, in irgendwelchen Debatten, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich werde ja auch ständig gefragt, ob ich zum Beispiel die Diskussionen von Donald Trump analysieren möchte. Mich interessiert das aber gar nicht, weil das ja eine Dritt- Überzeugung ist, also eine Überzeugung der Zuschauerschaft. Da ist die Rhetorik eine ganz andere, als wenn ich mein Gegenüber überzeugen möchte. Da kann ich mit meinem Gegenüber natürlich viel härter ins Gericht gehen. Das heißt, wir sind umgeben von falschen Vorbildern und glauben, wir müssten in Diskussionen mit dem Finger auf andere zeigen. Und wenn das nicht geht, dann ist die andere Person eben stur.
Macht es eigentlich auch Sinn, in eine Diskussion zu gehen, ohne eine eigene – starke – Meinung zu haben?
Ich wünschte mir, der Satz „Ich weiß es nicht“ würde viel öfter fallen, denn ein Gespräch kann durchaus auch zur Meinungsbildung da sein, also weil ich mehr über ein Thema lernen will. Man kann sich nicht zu jedem wirtschaftspolitischen Thema, zu jedem Unterthema des Klimawandels oder anderen komplizierten Fragen sehr gut auskennen.
Wichtig ist nur, dass man nicht in eine extreme Indifferenzhaltung kommt und einfach nichts sagt oder zu nichts eine Meinung hat. Dann würde diese Egal-Haltung als Entschuldigung dazu dienen, nie Farbe zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen.
Wertediskussionen sind ein heikles Thema. Auf der einen Seite gibt es Ansichten, von denen man sich entschieden distanzieren und abgrenzen sollte. Auf der anderen Seite frage ich mich oft auch, was die ganzen öffentlichen Ab- und Ausgrenzungen etwa im Politischen gegen Links und Rechts bringen bzw. ob nicht manche Haltung, die man vielleicht auch ablehnt, damit stärker gemacht wird.
Vieles, was heute in der Richtung gemacht wird, bringt gar nichts. Diese Aufforderungen vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen in diesem Jahr zum Beispiel, die lautete „Wählt demokratisch“ – aber die AfD gehört offiziell zur Demokratie. Auch ein Instagram-Status wie „Alle, die AfD wählen, können mir entfolgen“ oder „Wählt das Richtige“ überzeugt überhaupt niemanden – wie wir ja dann wieder gesehen haben. Es stärkt nur das Zusammengehörigkeitsgefühl derjenigen, die nicht die AfD wählen, und vielleicht sogar eine innere Überheblichkeit. Und es verhärtet die Fronten. Natürlich kann ich in diesem Fall nicht sagen: „Aber vielleicht haben diese Personen ja recht“ – das haben sie nicht. Menschen, die rassistisch denken, liegen falsch. Menschen, die das alte Frauenbild in die Moderne holen wollen, liegen falsch. So wie auch Menschen falschliegen, die sagen, die Erde sei eine Scheibe. Aber es ist eben trotzdem wichtig, mit diesen Personen kooperativ ins Gespräch zu kommen und sich anzuschauen:
Warum machen sie das, was sie machen? Was sind ihre Beweggründe? Was sind ihre Ängste? Und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie darüber offen reden dürfen. Denn wenn das nicht möglich ist, schwelt die Frustration im Untergrund weiter und wird größer. Und dann kommen Sätze wie ‚Man darf ja gar nichts mehr sagen‘.
Hier sind wir bei der Cancel Culture. Natürlich muss man bei manchen Aussagen mit einer sozialen Korrektur rechnen. Doch wie ahndet man Aussagen, die einfach nicht in Ordnung sind, ohne dass man Leuten das Gefühl gibt, „man dürfe ja nichts mehr sagen“?
Ich halte es für richtig, dass Menschen öffentlich zur Rede gestellt werden und dass sie sich als Konsequenz auch einige Kommentare gefallen lassen müssen. Zum Problem wird das, wenn es zu einer Cancel Culture wird: Hier findet ein Canceln viel zu schnell statt, bevor überhaupt der Kontext bekannt ist. Und fast noch schlimmer: Es gibt kein Verzeihen. Auf der einen Seite reden wir von Fehlerkultur, doch auf der anderen Seite gilt sie nicht für Menschen, die einen öffentlichen Fehler gemacht haben. Den gecancelten Menschen ist es oft gar nicht möglich, wieder integriert zu werden. Ihnen wird unterstellt, dass sie auf die falsche Weise bereuen, sich falsch entschuldigen oder es nicht ernst meinen. Diese beiden Aspekte machen die Cancel Culture problematisch. Da sollte man ansetzen.
Wenn man ein Gespräch auf Augenhöhe führen will – denn alles andere, haben wir gesehen, bringt sowieso nichts –, sollte man die Überzeugung des Gegenübers also zumindest als solche akzeptieren. Wenn wir andere überzeugen wollen, hört allerdings dort ja irgendwo schon der Respekt vor dem anderen Standpunkt auf, oder?
Etwas zu akzeptieren, bedeutet nicht, dass etwas unveränderbar ist. Manchmal ist es gut, nicht das Ziel zu haben, andere zu überzeugen, sondern, sie für den eigenen Standpunkt zu öffnen. Es gibt viele Themen, wo die Faktenlage nicht eindeutig ist. Deswegen sollten wir uns vor Augen führen, was John Rawls den „reasonable pluralism“ genannt hat. Dieses Konzept geht davon aus, dass Menschen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen können, obwohl sie sich jeweils genauso vernünftig mit dem Thema auseinandergesetzt und objektive Informationen eingeholt haben. Und wenn man das im Hinterkopf hat, sich also sagt, dass die andere Person, obwohl sie zu anderen Schlüssen kommt, vernünftig sein kann, dann wird man besser im Diskutieren. Man kann auch sagen:
Je weniger wir das Ziel haben, zu überzeugen, desto überzeugender sind wir.
Und zwar, weil wir dann keinen zu starken Druck ausüben.
Jetzt gibt es aber durchaus Ansichten, die, ich sage mal, gesellschaftlich schädlich sind und wo es, wie Sie selbst schon erwähnt haben, sehr klar ist, dass unser Gegenüber im Unrecht ist.
Auch da ist es so, dass wir besser überzeugen, je weniger wir diese Menschen überzeugen wollen. Das ist in solchen Fällen natürlich besonders schwierig. Hier hilft es, sich neben dem Ziel, das Gegenüber zu überzeugen, ein Zwischenziel zu setzen, und zwar, erst mal zu verstehen, warum die andere Person so denkt, wie sie denkt. Das ändert viel.
Sie glauben also auch, dass es an manchen Stellen einfach notwendig ist, andere zu überzeugen?
Bei gesellschaftlichen Themen ist es sehr wichtig, dass wir den Versuch starten, andere Menschen zu überzeugen, um ein gesellschaftliches Zusammenleben zu gewährleisten, um unsere Demokratie zu schützen. Uns können die Menschen nicht egal sein, die bei solchen Themen eine andere Meinung haben. Und da sollten wir alle Gesprächsführungsinstrumente ausprobieren und die Hoffnung nicht zu früh aufgeben – was leider viel zu häufig passiert.
Sie schreiben in Ihrem Buch davon, wie man Menschen überzeugen kann, die auf irgendeine Weise defensiv sind, die also zumindest emotional in der Diskussion sind. Was ist jetzt aber mit Menschen, die einfach gleichgültig sind? Nehmen wir etwa die Klimakrise: Wie überzeuge ich jemanden, sein Verhalten diesbezüglich anzupassen, dem es schlicht egal ist, was aus künftigen Generationen oder unserer Erde wird?
Eine sehr schwierige Frage. Hier müsste der Ansatz sein: Wie kann ich bei der anderen Person eine Emotion auslösen? Das haben wir ja bei ganz vielen Themen: Wenn keine persönliche Betroffenheit da ist, ist es den Leuten oft egal. Ich interessiere mich nicht für eine seltene Krankheit, bis auf einmal ein Familienmitglied daran erkrankt. Frauenquote ist nicht notwendig – bis dann der Vater merkt, dass seine Tochter es trotz guter Ausbildung irgendwie nicht schafft, richtig Karriere zu machen. Es gilt also, persönliche Betroffenheit auszulösen.
Und wie schafft man das?
Das geht über zwei verschiedene Wege. Zum einen, indem man die Person auf kurzfristige Folgen – in diesem Fall des Klimawandels – hinweist, die sie betreffen. Hier spielt es natürlich eine Rolle, was der Person wichtig ist. Ohne mich nun tief mit den eher kurzfristigen Folgen auseinandergesetzt zu haben – vielleicht ist die Person ein Sparfuchs, sodass man sagen könnte: „In den nächsten Jahren werden die Versicherungsbeiträge steigen in den Regionen, wo extremere Wetterverhältnisse herrschen. Das betrifft uns dann alle.“ Oder einer Person ist ihre Gesundheit besonders wichtig. Dann sagt man: „Diese Hitzewellen, die sind ja ziemlich belastend für unser Herz-Kreislauf-System. Da können wir durch gesunde Ernährung machen, was wir wollen, da kommen wir nicht gegen an!“
Das klingt einleuchtend. Und der zweite Weg?
Das Zweite wäre, einen Perspektivwechsel zu machen. Sich also zu fragen, welche Person dem Gegenüber wichtig ist. Vielleicht hat sie einen Neffen oder eine Nichte, die ihr am Herzen liegt, oder neulich auf dem Spielplatz das Nachbarskind gesehen, das sie besonders süß fand, wo man anknüpfen und sagen kann: „Stell dir mal vor, du bist das Nachbarskind und hast Spaß am Leben, freust dich auf deine Zukunft und musst dann irgendwann Angst vor Dürre haben, Angst davor, nicht genügend Nahrungsmittel zu haben.“ Hier ist es wichtig, konkret zu werden. Einen Perspektivwechsel kann man auch anstoßen, indem man eine Person an eine emotionale Situation erinnert: „Weißt du noch, als wir im Urlaub waren und dann auf einmal dieser Sturm kam? Da hattest du ja solche Angst, genau wie ich. So was will man in Zukunft ja nicht wirklich öfter erleben …“
Sie stellen in Ihrem Buch viele Techniken wie diese vor. In der tatsächlichen Diskussion ist es aber natürlich viel schwieriger, diese Techniken systematisch anzuwenden. Haben Sie Tipps, wie sich das üben lässt?
Mein Tipp ist, sich eine Technik rauszusuchen, die erst mal nah an der eigenen Persönlichkeit ist. Dann sollte man sich nicht den größten Kotzbrocken des Unternehmens zum Üben aussuchen, sondern erst mal mit Personen reden, mit denen man sich wohlfühlt, mit Freunden vielleicht. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eine positive Erfahrung macht, wenn man die Technik ausprobiert. Und dann kann ich mich langsam vorarbeiten zu Techniken, die weiter weg sind von meiner eigenen Persönlichkeit. Die sollten allerdings auch geübt werden; ich will ja mein Kommunikationsmuster erweitern.
Zu Anfang haben Sie erwähnt, dass Menschen gerade bei Themen, die ihnen wichtig sind, schnell emotional werden. Was kann man tun, wenn man merkt, dass man in seiner Kommunikation nicht mehr so kontrolliert ist, wie man es gern wäre?
An der Einstellung zu Emotionen zu arbeiten, kann einen schon lockerer machen.
Ich werde ständig gefragt: ‚Wie kann ich ruhig bleiben?‘ Und meine erste Antwort ist immer: Ihr müsst gar nicht ruhig bleiben.
Keine Angst vor Emotionen! Es ist okay, wenn eine Diskussion leidenschaftlich wird. Wir kommen ganz schnell in eine Situation, in der wir denken: „Was mache ich hier eigentlich? Das, was jetzt gerade passiert, darf nicht passieren. Ich habe gerade was Falsches gesagt. Die andere Person wird gerade lauter.“ Doch, das darf sehr wohl passieren! Eine positive Gesprächskultur speist sich auch daraus, dass Diskussionen leidenschaftlich geführt werden. Und wenn ich mir das erst mal bewusst mache, habe ich automatisch weniger Druck. Emotional zu werden, bedeutet erst mal nur, dass einem die Sache am Herzen liegt. Dasselbe gilt für das Gegenüber.
Gibt es noch weitere Dinge, die man vielleicht auch im Vorfeld tun kann?
Abgesehen davon sollte man dem anderen nicht dauernd das Schlechteste unterstellen. „Die ist narzisstisch“, „Der respektiert mich nicht“. Viel besser ist es, positive Unterstellungen zu machen und sich zu fragen: Okay, was könnte denn der positivste Grund sein, dass die Person sich gerade so verhält? Wenn sie mich unterbricht, ist sie vielleicht einfach nur impulsiv oder verliert ihren Gedanken, wenn sie nicht sofort ihren Redebeitrag loswird. Das tut man am besten vor dem klärenden Gespräch – solchen komplexen Gedanken kann man währenddessen nicht nachgehen. Schließlich sollte man die eigenen Erwartungen zurückschrauben. Das Ziel sollte nicht sein, die Person mit der besten Technik sofort zu überzeugen. Das erzeugt bloß Enttäuschung. Am besten setzt man sich erst einmal das kleinere Ziel, den eigenen Standpunkt klar zu platzieren. Dann habe ich viel schneller ein Erfolgserlebnis und kann viel ruhiger sein, weil ich diese Ohnmacht, wenn mir das Überzeugen nicht gelingt, umgehe.
Über die Autorin
Marie-Theres Braun ist Trainerin für Rhetorik und Verhandlungsführung. Zu diesen Themen hält sie Vorträge und Kommunikationsseminare für Unternehmen innerhalb der DACH-Region sowie darüber hinaus.












