„Riskieren Sie lieber viele kleine Krisen als die eine, lang negierte große.“

Herr Rühl, Sie haben unter anderem als Leiter von Notfallleitstellen, als Rettungsassistent und im Katastrophenschutz gearbeitet. Heute beraten Sie Unternehmen in Sachen Krisenfestigkeit. Wie kommt es, dass Sie Ihr Buch Unternehmerische Resilienz mit einem Zitat Mr. Spocks aus Star Trek – „Dif-tor heh smusma“, vulkanisch für „Live long and prosper“ – einleiten?
Die Serie hat mich als junger Mensch geprägt und zwar in mehrfacher Hinsicht: Schon bevor ich mich entschloss, in der sogenannten „Blaulicht-Welt“ der Gefahrenabwehr tätig zu sein, beschäftigte ich mich viel mit Telekommunikationstechnik. Schon als Sechzehnjähriger war ich fasziniert von Computern und IT, arbeitete nebenbei in der freiwilligen Feuerwehr, absolvierte später meinen Zivildienst bei den Rettungssanitätern – und abends schaute ich Star Trek. Ich war ein „Nerd“, würde man heute sagen. Und bereits als Kind hatte ich mit einer alten Schreibmaschine und einem ausgemusterten Telefon „Büro“ gespielt. Als die Sicherheit von Geschäftsprozessen in Deutschland dann Anfang der 2000er Jahre einen Abschwung erlebte, entschied ich mich, das Know-How aus der Blaulicht-Welt in die Unternehmenswelt zu bringen. Dort hatte man spätestens vor dem Jahr 2000 – und mit den Sorgen um die Millennium-Bugs – festgestellt, dass eine systemische Vorbereitung auf Krisen helfen kann, Unternehmen resilienter zu machen. Und was wäre ein besseres Motto für die Arbeit eines solchen Unternehmens als die Worte Mr. Spocks?
Also dann, „Energie!“, wie wir später geborenen „Star Trek: Next Generation“-Gucker sagen würden: Was sind die drei wichtigsten Regeln für das Krisenmanagement von Unternehmen?
Erstens: Sie müssen definieren, was Ihr Unternehmen als „Krise“ versteht. Aus der Blaulicht-Welt weiß ich: In eine Katastrophe „schlittert“ man nicht hinein, eine Katastrophe wird „erklärt“. Denn:
Situationen lassen sich nicht beherrschen, wenn keine Einigkeit über die Lage besteht.
Uwe Rühl
Genauso wie in Leitstellen eine Katastrophen- oder Sonderlage erklärt wird, muss auch in Unternehmen eine Krise verbindlich erklärt werden.
Wie funktioniert das im Detail?
Ich schaue mir bewusst an, wie die Situation aussieht, und warum mit den üblichen Führungsinstrumenten in dieser Lage nichts zu machen ist – und erkläre eine Krise. Dazu gehört im Unternehmenskontext zwingend auch eine Definition dafür, wann und unter welchen Umständen die Krise wieder beendet ist. Die Coronakrise ist ein Paradebeispiel dafür: Wann beende ich ein Coronakrisen-Board, wie es viele Firmen im Februar oder März 2020 eingeführt haben? Das mag von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, aber man muss definieren, dass sie unter bestimmten Umständen bewältigt ist, und wer darüber entscheiden soll. Oft ist die Erklärung einer Krise einfacher als ihre Beendigung.
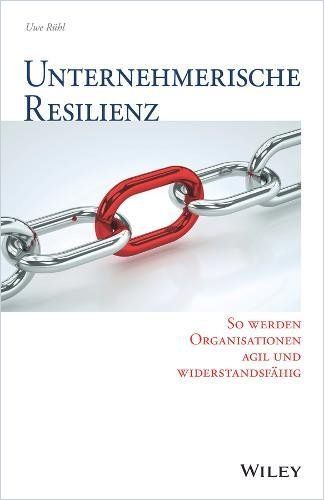
Nun haben Sie zur Bewältigung noch nichts gesagt.
Dazu muss man die zweite Regel für das Krisenmanagement von Unternehmen befolgen: Finden Sie Krisenhandwerker im eigenen Unternehmen, bringen Sie sie so früh wie möglich zusammen, und hören Sie auf sie. Krisenmanagement ist nichts anderes als Handwerk, und zum Handwerker werden Sie nicht, wenn Sie die Theorie beherrschen, sondern wenn Sie selbst mal Krisen gemanagt haben. Deshalb tut die Unternehmensführung gut daran, im eigenen Unternehmen lange vor einem Ernstfall die Krisenhandwerker zu identifizieren: freiwillige Feuerwehrleute, Menschen mit militärischer Erfahrung oder ehemalige Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks. Diese Krisenhandwerker müssen fortan im Krisenfall die Informationen, die verfügbar sind, prüfen, bewerten, eine Lage beurteilen und kommunizieren können, und Empfehlungen dazu geben, wie zu reagieren ist.
Wie sieht das konkret aus?
Wie der sogenannte Katastrophenschutzstab in der Blaulicht-Welt: Da gibt es einen „Sichter“, der die eingehenden Meldungen prüft. Es gibt jemanden, der sich die Situation vor Ort anschaut und die Lage für alle leicht verständlich darstellt. Es gibt jemanden, der den Kontakt zu den beteiligten Notfallteams hält und die Lage bearbeitet usw. Übertragen auf den Wirtschaftskontext:
Es sollte klar aufgeteilte Funktionen des Krisenmanagements geben, und diese Krisenhandwerker sollten dann im Ernstfall ganz genau wissen, was ihre Aufgaben sind, was nicht – und wie lange sie gebraucht werden.
Uwe Rühl
Das heißt: Die beliebten „Katastrophenschutzpläne“ sind gut und schön, aber wichtiger ist es eigentlich, ein gut aufgestelltes Team zu haben, das weiß, wie es im Ernstfall handeln muss?
Ja. Sie können schlicht nicht alles planen. Und Katastrophen sind Katastrophen, weil man sie eben vorher nicht auf dem Zettel hatte – oder haben konnte. Sie passieren! Egal, wie gut man glaubt, vorbereitet zu sein. Und dann, im Ernstfall, helfen Ihnen vor allem die Handwerker. Denn die verfallen nicht in Panik und Aktionismus. Strukturell sind Katastrophen und ihre Bewältigungsmechanismen übrigens nicht so verschieden, selbst wenn alle glauben, nun sei alles anders oder neu. Deshalb gilt: Üben, üben, üben! Das ist meine dritte Regel für erfolgreiches Krisenmanagement in Unternehmen.
Wie „übt“ man denn Krise? Und: wie findet man im Arbeitsalltag Zeit dafür?
Guter Punkt. Üben ist nervig, denn es kostet Zeit und Energie. Das ist in Unternehmen nicht anders als bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber sie gehören dazu. Nicht dreimal wöchentlich, aber doch öfter als alle drei Jahre mal. Und natürlich muss daran nicht das ganze Unternehmen beteiligt sein! Wenn die Krisenhandwerker sich einmal im Quartal zusammentun, Abläufe einstudieren und sich gegenseitig testen – das heißt: ein Szenario ausdenken und entsprechend ihrer Rollen reagieren – reicht das schon. Abläufe sind alles! Deshalb gilt auch: Jede dieser Krisenhandwerkerpositionen sollte dreifach besetzt sein. Wenn einer krankheitsbedingt ausfällt und ein anderer gerade im Urlaub ist, haben Sie dann wenigstens einen Dritten zur Hand, der seine Zuständigkeiten kennt. Kann seine Position im Ernstfall nicht besetzt werden, steigt die Gefahr, dass der Informationsfluss versickert und das Chaos nur noch größer wird.

Diese Krisenhandwerker unterstützen und entlasten dann also das unternehmerische Führungsteam beim Entscheiden. Was ist aber, wenn der CEO glaubt, es selbst am besten zu wissen?
Beim Thema Hierarchien hilft es, die Zuständigkeiten und Befugnisse im Vorfeld zu definieren. Wenn eine Führungskraft den Sinn eines neuen Krisenmanagementsystems sieht, sollte sie auch einsehen können, dass die Krisenhandwerker im Zweifel mehr Befugnisse haben als viele andere Entscheider im Unternehmen – und ein CEO, der von seinen Handwerkern überzeugt ist, wird dann auch im Einklang mit ihnen entscheiden. Außerdem hilft es, wenn die Leitung des Krisenstabs an jemanden übertragen wird, der innerhalb des Unternehmens auch im ökonomischen Führungsteam sitzt. So ist gewährleistet, dass Teile des Unternehmens, die von einer Krise nicht betroffen sind, unbehelligt vom Management derselben bleiben – und Abteilungen, die besonders betroffen sind, involviert werden.
Ein Datenschutzvorfall mit großer Wirkung in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, braucht andere Entscheider im Krisenstab als die Corona-Pandemie.
Uwe Rühl
Nun die Probe aufs Exempel: Kennen Sie Unternehmen, denen das Befolgen dieser drei Regeln auch bei der Bewältigung der aktuellen Coronakrise geholfen haben?
Jede Menge. Ein großer deutscher Konzern, den ich berate, hat genau mit den eben genannten Basisfunktionen einen Krisenstab aufgebaut, und nutzt ihn aktuell, um zu steuern, wie man auf die Pandemie reagiert. Nach einem anfänglich starken Ausbau des Stabs, als immer mehr Reisewarnungen ausgesprochen wurden, erste Schließungen von Schulen, Unternehmen, Stadtvierteln oder Regionen in Asien bekannt wurden, ist der Konzern aktuell daran, den Stab wieder etwas zurück zu bauen, da einige Ziele, die er mit dem Krisenmanagement erreichen wollte, erreicht sind. Die Krise ist also in einigen Teilen des Unternehmens nun keine „Krise“ laut gefasster Definition mehr. Ein anderes Unternehmen, das in der Reisebranche tätig ist, und dessen wirtschaftliche Situation sich zusehends verschlechtert hat, baut hingegen den Stab aktuell weiter aus – da sich erste Annahmen zur Erholung der Situation nicht bestätigt haben. Nun ist dort ein erweitertes Krisenmanagement gefordert. Allerdings: Der Stab hat gleich zu Beginn der Krise damit begonnen, unterschiedliche Szenarien zum Verlauf der Krise durchspielen zu lassen. Deshalb hat die Firma nun mehrere Handlungsoptionen, die nicht erst noch entwickelt werden mussten, als es schlimmer wurde. Das Denken in Optionen spart also nicht nur wertvolle Zeit, es macht Firmen resilienter – selbst dann, wenn sich die Krisensituation verschärft.

Der getAbstract International Book Award wird seit 2001 jährlich an Titel vergeben, die aktuelle wirtschafts- und businessrelevante Themen auf außergewöhnliche Weise in den Mittelpunkt rücken. In diesem Jubiläumsjahr wird der Preis symbolisch durch eine Reihe von Interviews und Online-Events verliehen. Mehr Informationen finden Sie hier.
Das ist ein gutes Stichwort. Resilienz, dieses magische Wörtchen, das ursprünglich aus der Physik kommt, aber in der Psychologie Karriere gemacht hat, übertragen Sie auf den Firmenkontext: In der „Organizational Resilience“, so schreiben Sie, geht es vor allem darum, teilweise widersprüchliche Ansätze miteinander ausbalancieren zu müssen.
Und das Hauptproblem ist nicht, in widersprüchlichen Szenarien zu denken, sondern beim Eintreten eines Szenarios auch kurzfristig reagieren zu können. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens ist dieses – nun immer häufigere – kurzfristige Reagieren auf strategischer Ebene enorm anstrengend, denn es wird häufig als „Herumschlingern“ interpretiert. Dabei ändert sich in der VUKA-Welt nicht die Strategie von erfolgreichen Unternehmen, sondern es verschieben sich ständig die Gewichte zwischen Stabilität und Flexibilität. „Live long and prosper“: Dazu müssen sie leben, eine gewisse Stabilität haben, einen funktionierenden Geschäftsbetrieb. Aber zum Prosperieren reicht das allein heute nicht mehr. Sie müssen auf Veränderungen im Markt schneller reagieren als früher – und dazu brauchen Sie natürlich geeignetes Personal, Ideen und am Ende auch neue Dienstleistungen und Produkte.

Stichwort Personal: Was heißt hier „geeignet“?
Wenn die Coronakrise eines gezeigt hat, dann die Tatsache, dass Dinge sich rasant ändern können – das gilt für das Unternehmensumfeld ebenso wie für Unternehmen. Viele von uns sind aber noch die Zeiten gewöhnt, da Wirtschaft eine Art langsamer Aufzug war: Es ging immer leicht bergauf, dafür konstant. In Zeiten weltweiter Konkurrenz haben sich die Regeln verändert! Menschen müssen in die Lage versetzt werden, mit vermeintlichen Widersprüchen zurechtzukommen. Etwa etablierte Produkte zur höchsten Kundenzufriedenheit zu produzieren und gleichzeitig an völlig neuen Ideen zu arbeiten. Ein schönes Beispiel für dieses Mindset ist die Entstehung sogenannter Strandkorbkonzerte. Wir alle wissen, dass die Festival- und Konzertindustrie aktuell ganz besonders unter den neuen Auflagen leidet. Aber statt zu resignieren, besinnt sie sich auf ihre Stärke: Konfrontiert mit neuen Hygiene- und Abstandsregeln kam einigen findigen Konzertveranstaltern die Idee, das bis anhin erfolgreiche Konzept leicht zu modifizieren. Sie fragten sich: „Was sorgt dafür, dass man ein einmaliges physisches Erlebnis hat, aber sich trotzdem nicht ansteckt?“ Die Antwort: Stellt Strandkörbe auf! Aus der vermeintlichen Schnapsidee, einem Notnagel, ist dann in Windeseile eine ganz eigene Art von Konzerterlebnis geworden, die so erfolgreich ist, dass nicht nur der Begriff „Strandkorbkonzert“, sondern auch das zugrundeliegende Konzept die Pandemie überdauern werden.
Die besten Chancen, solche Erfolgsgeschichten zu schreiben, haben Sie, wenn Sie in Ihrem Unternehmen quasi zwei Firmen in einer haben: Eine stabile Firma mit gesundem Geschäftsmodell, und eine disruptive Firma, die das Modell ständig mit neuen Produktideen erweitert oder sogar infrage stellt.
Uwe Rühl
Viele Grossunternehmen leisten das, indem sie sogenannte Inkubatoren innerhalb der eigenen Firma mit besonderen Rechten und Geldern ausstatten. Halten Sie das für sinnvoll?
Sogar für sehr sinnvoll. Schwierig wird es meist erst dort, wo die Kulturen der beiden Teile nicht zusammenpassen – obwohl sie das im richtigen Moment sollten. Wenn also die Projekte aus dem Reich des Inkubators Teil des Reichs der Produktion werden sollen. Vorrangig müsste man es also schaffen, beide Welten soweit miteinander kompatibel zu machen, dass sie keine gänzlich verschiedenen mehr sind. Starre Kulturen auf beiden Seiten müssen abgebaut werden. Sonst dreht eine superwendige Schnellboot-Idee aus dem Inkubator schnell mal ihre Ründchen im Pool an Deck des Mutterschiffs, das im schlechtesten Fall eine Art lahmer Supertanker ist.
Bei vielen kleineren Unternehmen reichen aber doch oft schon die Ressourcen nicht, um solche Inkubatoren zu installieren. Wie gehen die vor?
Die Kernkompetenz heutiger Führung muss es sein, alle mitzunehmen. Sie müssen sich fragen, was Sie mit den Ressourcen machen, über die Sie verfügen. Oft sind die gar nicht so viel kleiner – sie werden nur nicht genutzt, weil die Kultur eine Nutzung verunmöglicht. Diese Fragen muss auch ich mir mit unserem Unternehmen, das über rund zwanzig Mitarbeiter verfügt, ständig stellen. Wie kann ich Teammeetings nutzen, um die Kreativität zu fördern? Wie komme ich ohne große Umwege zu einer Lösung, mit der man experimentieren kann? Wie kann ich einen schnellen Prototyp bauen? Natürlich kostet das Zeit und Energie, erfahrungsgemäß sind das aber gar nicht die unternehmensinternen Engpässe.
Resilienz heisst eben nicht: Alles prallt an mir ab. Es heisst: Ich kann mich anpassen, adaptieren, dazulernen.
Uwe Rühl
Sie raten zum Grundsatz „Anders statt immer nur besser“. Anders kommt aber häufig nur auf Druck von außen zustande. Ein schönes Beispiel: Remote Working. Was gestern aus den verschiedensten Gründen für die Personalverantwortlichen „unmöglich“ schien, ist heute weit verbreitet. Und erst damit hat sich das Mindset geändert. Erhöht diese gestiegene Flexibilität auch die Resilienz von Unternehmen?
Diese Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten. Ich würde aber behaupten: Flexibilität und Kreativität entstehen durch bessere Interaktion. Und je nachdem, woran Sie gerade mit anderen zusammenarbeiten, kann das Home Office Ihnen bessere oder schlechtere Interaktionsmöglichkeiten bieten. Wenn Ihr Unternehmen vor Corona schlecht vernetzt und digital eher „konservativ“ unterwegs war, sind die generellen Interaktionsmöglichkeiten heute wahrscheinlich zahlreicher geworden – und das tut natürlich dann auch neue Türen bei der Rekrutierung von Personal auf, erlaubt das Renovieren des eher in die Jahre gekommenen Büros usw. Das ist alles gut…
…aber?
Wenn Sie aber kreativ interagieren wollen, vielleicht spielerisch an einem Ansatz arbeiten, dann setzt Ihnen die räumliche Trennung auch neue Grenzen – aller digitaler Tools, die das gerade zu lösen versuchen, zum Trotz. Auch hier haben wir es also mit gleichzeitigen, sich aber nicht immer eindeutig zueinander verhaltenden Entwicklungen zu tun. Und da muss man seinen besten Weg eben finden. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir am Schluss der Pandemie irgendwo in der Mitte landen würden – also die physische und die digitale Interaktion dort einsetzen können, wo sie für unseren Zweck am besten eingesetzt ist.
Wie sieht ein zukunftsfähiges, Resilienz-förderndes Büro aus?
Flexibel. Das wäre es in einem Wort.
Bedeutet?
Viele Räume sollten nicht von vornherein nur einem Zweck dienen, sondern variabel nutzbar sein. Abtrennbar, schnell umgestaltbar, ohne zu viel fest verplante Flächen. Wenn Einzelarbeit und Konzentration angesagt sind, muss das möglich sein; wenn Teamarbeit gefragt ist, auch das. Sie sollten offene Bereiche des Austauschs schaffen – denken Sie an Interaktion und Kreativität. Aber brauchen Sie wirklich noch ein einziges, großes, one-size-fits-all Großraumbüro? Ich bezweifle es. Aus hygienischen Gründen, aber auch aus menschlichen: Wir sind eben nicht alle gleich, wenn es um unsere ideale Arbeitsatmosphäre geht – und ein Arbeitsplatz der Zukunft sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Damit erhöhen Sie die Resilienz Ihrer Mitarbeiter, und die sind es ja, auf die Sie sich in einem Krisenfall verlassen können müssen.

Menschen sind aber auch die potenziell größte Fehlerquelle, nicht?
Ja, die erste Reaktion des Menschen in einer unerwarteten, vielleicht gefährlichen Situation ist Stress, und unter Stress macht man Fehler. Der Grund: Ihr Körper flutet Sie mit Adrenalin. Und Sie reagieren darauf mit Freeze, Fight oder Flight – entscheidend im Umgang damit ist die Stabilität der Person, und die können Sie fördern oder eben nicht.
Das gehört auch zum „Üben“, das Sie eben meinten?
Genau. Sie können durch Krisenmanagement eine Krise nicht verhindern, aber verkürzen. Nehmen wir den „Freeze“, die Schockstarre. Die können Sie verkürzen, indem Sie der Situation den Schock nehmen – weil sie mit ihr, wenn auch vielleicht nicht in genau dieser Form, rechnen. Stichwort: Eingespielte Strukturen und Kommunikationswege. Die sorgen dafür, dass Sie bestenfalls sogar produktiv reagieren.
Kürzlich habe ich an einem Unternehmerforum einen CEO kennengelernt, der sagte, er habe in der Anfangsphase der Coronakrise keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Er war völlig absorbiert davon, konnte nicht mehr unternehmerisch denken – Freeze! Aber: Das lässt sich durch Üben verhindern.
Uwe Rühl
„Fight“ kann eine weitere Option sein, sie ist aber häufig überhastet, unkoordiniert, und deshalb zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie sich hingegen mit Szenerien auf einen Kampf vorbereitet haben, haben Sie auch Optionen zu Attacke und Verteidigung. Wer im Affekt wild um sich schlägt, hat das meistens nicht.
Und die Flucht?
„Flight“? Sollten Sie, wenn überhaupt, nur nach vorn antreten. Haben Sie für diese Situation trainiert, steigen Ihre Chancen – nicht nur die des Überlebens, sondern sogar die des Prosperierens.
Sie schreiben, dass es eine der größten Gefahren für Unternehmer in Krisenzeiten ist, „die Realität zu verleugnen“. Aber: Woher weiß ich denn, ob ich mich der Realität stelle – oder doch nur meiner eingeschönten Version davon?
Das ist schwierig. Ganz grundsätzlich hilft es, sich mit Leuten zu umgeben, die dasselbe Ziel haben, wie Sie – nämlich: „Live long and prosper“ (lacht) -, aber eben nicht immer einer Meinung mit Ihnen sind. Umgeben Sie sich mit Leuten, die anders sind als Sie! Die auch seriöse Quellen konsultieren, aber vielleicht aus anderen Bereichen als Sie.
Umgeben Sie sich mit kreativen und eher nüchternen Menschen, mit Theoretikern und Praktikern, mit Optimisten und Pessimisten. Und schauen Sie sich dann gemeinsam die Fakten an, die alle zusammentragen.
Uwe Rühl
In Ruhe, unbeeindruckt, konzentriert. Fragen Sie sich im Hinblick auf Corona zum Beispiel: Was heißt es für uns, wenn die Pandemie noch drei Jahre weitergeht? Was, wenn es nächsten Monat einen Impfstoff gibt? Welche Hinweise haben wir auf die Wahrscheinlichkeit der Szenarien? Und: Probieren Sie lieber etwas mehr aus als etwas zu wenig. Riskieren Sie lieber viele kleine Krisen als die eine, lang negierte große.
Wie soll man als Führungskraft mit Fehlern umgehen?
Wenn ein Fehler passiert: Akzeptieren, dass er passiert ist. Sie können es nicht mehr ändern – und die Probleme sind jetzt zum Lösen da.
Um die Frage der Schuld geht es also gar nicht?
Nein. Shaming and Blaming hilft niemandem weiter, schadet nur. Natürlich gibt es meist Verantwortliche für einen Fehler, aber die sind – so sehe ich das – zuerst Teil der Lösung, nicht des Problems. Ein Beispiel: Als Verantwortlicher in einer Rettungsleitstelle habe ich einmal ein Rettungsfahrzeug in die falsche Richtung geschickt. Ein kapitaler Bock, und keine Frage – das war meine Verantwortlichkeit. Aber: Ich habe den Fehler bemerkt, kommuniziert, und ich war eben auch in der Lage, ihn mit allen anderen gemeinsam zu korrigieren. Daraus habe ich gelernt, dass es sich lohnt, eine Unternehmenskultur zu pflegen, in der man auch auf Fehler hinweisen darf, sie aussprechen darf. Existieren dazu keine geeigneten Mechanismen, eventuell auch kein Vertrauen, befinden Sie sich im permanenten unternehmerischen Blindflug. Und der endet, das wissen wir, immer in der Katastrophe.




