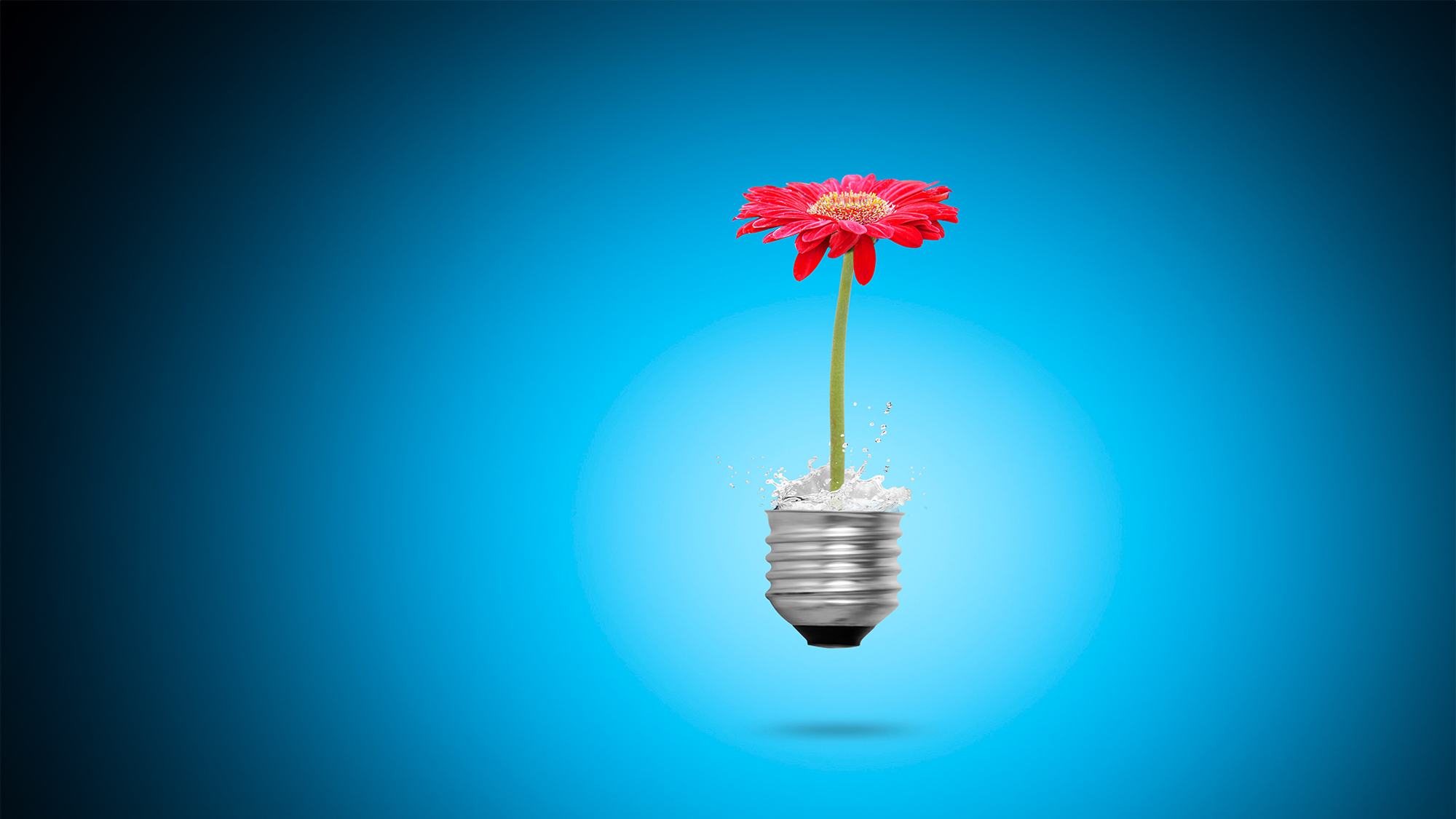Eine erschöpfte Mehrheit

Quiet Quitting ist in aller Munde. Gemeint ist eine Einstellung, die früher „Dienst nach Vorschrift“ und „innere Kündigung“ hieß, später dann „freizeitorientierte Schonhaltung“. Quiet Quitters sind Angestellte, die zwar da sind, aber nicht mehr dabei – und die problemlos zustimmen, wenn der Chef sagt, dass das Wasser den Berg hinauffließt. Sie planen einen Stellenwechsel oder gar die „Great Resignation“, den Totalausstieg aus der Arbeitswelt. Dabei ist es nicht nur jugendliche Müdigkeit, die Menschen anwesend abwesend sein lässt, nicht nur Kapitalismuskritik oder „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ – so ein aktueller Buchtitel. Es gibt auch viele unternehmensinterne Anstöße.
Vor diesem Hintergrund erinnere ich ein mitternächtliches Gespräch zwischen fünf Managern – alles Männer zwischen 28 und 45 Jahren. Ich fasse zusammen: Sie fühlen sich im Unternehmen zurückgesetzt, übergangen, nicht mehr „zu Hause“.
So wurde die Karriereleiter, die einst Individuum und Unternehmen innig verband, in den letzten Jahren immer kürzer.
Dennoch hatten sie erwartet, vorwärtszukommen, wenn sie gute Arbeit leisten und sich geduldig in die Warteschlange zur Unternehmensspitze stellen. Nun aber kommen andere daher und beanspruchen nicht nur irgendwelche Plätze, sondern die besten: angeheuerte, bislang organisationsferne „Experten“, Frauen extra für den Aufsichtsrat, Frauen überhaupt, diverse Vertreter minoritärer Gruppen, hyperindividualisierte Schnösel der Generation Z.

Dadurch wird es nicht nur eng in der Warteschlange, es ändern sich auch die Selektionskriterien: Plötzlich berechtigt nicht mehr Leistung dazu, weiter vorne zu stehen, sondern Merkmale, Identität oder Herkunft. Die eigene Lebensweise des Sich-Anstrengens, Wartens und Loyalseins wird als rückständig erlebt. Vor allem die beiden jüngsten Manager fühlten sich sogar in ihrem Mannsein diffamiert, in ihren Berufs- und Lebensplänen behindert. Man gelte ja nicht mehr als Mensch, sondern nur noch als Frau oder Mann. Individualität zähle nicht mehr, gefragt sei stattdessen die „richtige“ Gruppenzugehörigkeit. „Wie im Mittelalter.“ Das alles überformt vom Harmoniediktat in unsicheren Zeiten und einer Rhetorik der Alternativlosigkeit. Deshalb protestiert man auch nicht, sondern hält lieber den Mund.
So weit meine Erinnerung. Man mag rufen:
Heult leiser, Jungs!
Aber die bürgerliche Gesellschaft hatte die mittelalterliche Ständegesellschaft einst mit dem Versprechen abgelöst, dass Leistung dem Einzelnen seinen Platz in der Gesellschaft zuweise – und nicht länger die Zugehörigkeit zu sozialen, sexuellen, ethnischen oder sonstigen Gruppen. Das hat zu einem beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Die Ausbildung junger Führungskräfte ist schwer denkbar ohne die Prämisse, dass Leistung – der richtige Einsatz von Fähigkeiten bei anhaltender Ausdauer – sich lohne.

Unscharfer Leistungsbegriff
Zwar war es schon immer nur halb richtig, dass in Unternehmen einzig die Leistung zählt – zu unscharf ist der Leistungsbegriff, zu unterschätzt der Zufall. Und natürlich ist es richtig, offene Stellen und neue Leitungspositionen nicht mit den immer gleichen – meist männlichen – „Best Buddies“ aus der Mitternachtsrunde zu besetzen.
Aber Unternehmen sollten sich gut überlegen, ob sie es sich in Zeiten von Personalknappheiten „leisten“ können, das Leistungsprinzip mal schleichend, mal marktschreierisch durch Identitätsmerkmale zu ersetzen und so in einen Feudalismus zurückzufallen, der im Namen der Antidiskriminierung individuelle Rechte durch Kollektivrechte (und Fairness durch Bevormundung) ersetzt.
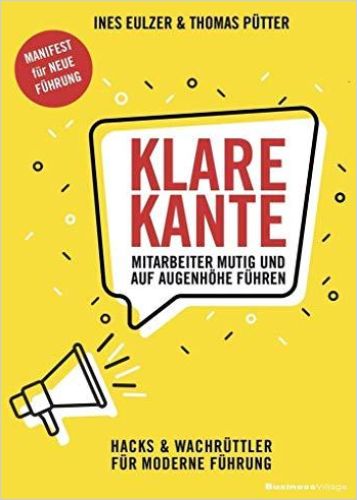
Ein Unternehmen darf im Bestreben, allen gerecht zu werden, nicht zu einer toxischen Mischung aus inklusiver Behandlung merkmaldefinierter Anspruchsgruppen, achtsamem Umgang mit Problemen und doktrinärem Duckmäusertum verkommen.
Innovationskraft, Mitarbeiterbindung und am Ende auch die Reputation, die ja auf diesem Wege meist verbessert werden soll, leiden darunter.
Mindestens sollten wir, wenn wir es mit der Gerechtigkeit und der Gleichbehandlung wirklich ernst meinen, die Gefühle des Abgedrängtwerdens einer unternehmerischen Kerngruppe nicht ignorieren – jener leistungsbereiten, aber „erschöpften Mehrheit“, die, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, sexueller oder religiöser Orientierung usw., den Eindruck hat, in der gegenwärtigen Hysterie erst nicht mehr zu Wort und dann nicht mehr zum Zuge zu kommen. Denn: Wir können sicher sein, dass wir alle dereinst dazugehören werden.
Nächste Schritte
Bestellen Sie Reinhard K. Sprengers neues Buch hier. Wer den Autor für einen Live-Event buchen will, erreicht das Management hier. Und hier finden Sie alle seine getAbstract-Kolumnen seit 2020.