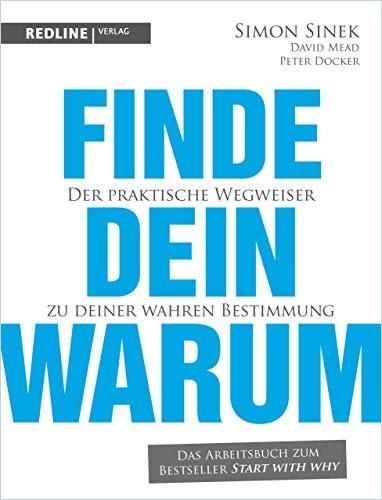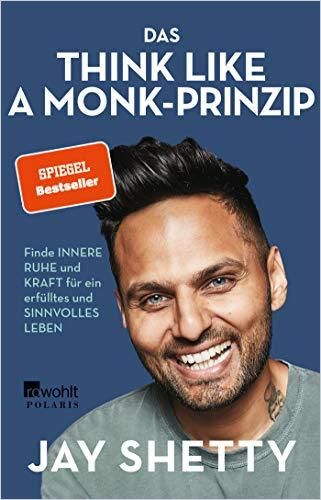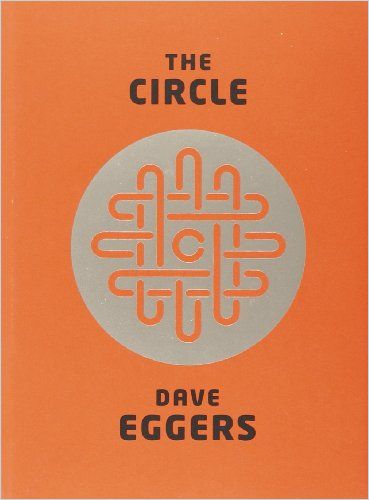Das Problem mit dem Purpose

Als der Bergmann Alexei Grigorjewitsch Stachanow 1935 im ukrainischen Donbass angeblich die märchenhafte Menge von 102 Tonnen Steinkohle statt der üblichen 7 hackte, verfolgte er damit einen wahrhaft noblen Purpose: die Steigerung der sowjetischen Arbeitsproduktivität. Schon bald entstand nach seinem Vorbild die Stachanow-Bewegung, die das sozialistische Arbeitsvolk zu Höchstleistungen anstacheln sollte – und ihrem Namensgeber den Hass vieler Kumpel eintrug.
Stachanow erhielt zum Lohn ein schickes Haus und einen komfortablen Büroposten, fiel aber irgendwann in Ungnade und trank sich einsam und verbittert zu Tode. Heute würde man sagen: Er war frustriert und ausgebrannt.
Die nächste „Sau im Managementdorf“?
Natürlich haben demokratische, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnungen der Gegenwart kaum etwas mit dem menschenverachtenden Stalinismus von damals gemein. Doch in einem Punkt gibt es Parallelen: der eifrigen Suche nach dem noblen Purpose, einem höheren, gesellschaftlichen Sinn im Job. Der Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm nennt das im Vorwort seines jüngsten Buchs eine „quiekende Publicity-Sau, die grunzend durchs New-Work-Dorf getrieben wird“.

Er hat zwar kein Problem mit dem Sinn an sich. Nur sollten wir nicht zwanghaft bei der Arbeit danach suchen, findet er. Vor allem dann nicht, wenn findige Marketing- und PR-Strategen jeder noch so banalen Unternehmung einen vermeintlich höheren Zweck verpassen. Wenn also ein Versandhandel nicht mehr Klamotten verkauft, sondern behauptet: „We reimagine fashion for the good of all“. Am Anspruch, mit ihrem Job die Welt zu retten, scheitern die meisten – und damit oft auch an ihrer persönlichen Sinnsuche.
Wenn wir tatsächlich alle nur bei Jobs bleiben wollten, in denen wir unmittelbar Gutes und Richtiges für die Gesellschaft tun, wären viele von uns arbeitslos.
Ingo Hamm

AAA – ambitioniert, arglos, ausgebeutet
Eine jüngere Generation US-amerikanischer Autorinnen geht in ihrer Kritik des reinen Purpose noch einen Schritt weiter. Millennials wie Sarah Jaffe und Anne Helen Petersen quittieren das New-Work-Motto „Mach einen Job, den du liebst, und du wirst keinen Tag in deinem Leben arbeiten“ mit einem müden Lächeln. Für sie werden damit nur bestehende Ungleichheiten verschärft.
Hinter dem Mythos von der „Liebe zur Arbeit“, so Jaffe, verstecke sich nicht mehr als knallharte Ausbeutung. Mehr noch: Jobanfänger müssten heute nicht nur ihre Eltern zufriedenstellen und eine sichere Anstellung ergattern, sondern in den Augen ihrer Peers auch noch für coole Jobs „brennen“ und ihre Arbeitgeber als „große, glückliche Familie“ in die Arme schließen.
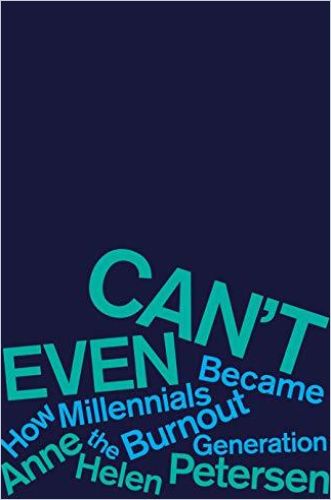
Längst reicht es nicht mehr aus, einfach seinen Job zu machen. Wir sollen außerdem noch dankbar dafür sein.
Und der Lohn für die bedingungslose Hingabe? Unbezahlbare Studentendarlehen, unterbezahlte Gig-Arbeit und Burn-out. Nicht die Arbeit an sich macht uns fertig, sondern das Scheitern an den eigenen, zu hoch gesteckten Erwartungen: Die Liebe zum Job wird so zum marktwirtschaftskompatiblen Wiedergänger der sozialistischen „Übererfüllung der Arbeitsnorm“.

Was sinnvoll ist: faire Arbeitsverhältnisse für alle
Keine Frage, eine sinn- und identitätsstiftende Arbeit ist ein Geschenk des Himmels. Sie wird jedoch zum Fluch, wenn mit dem Job auch die Identität wegbricht oder wenn die Identifikation damit so hoch ist, dass sie, wie in vielen Non-Profit-Organisationen üblich, mit Selbstausbeutung einhergeht.
Besonders bitter ist dieser hehre Anspruch für die weltweit große Mehrheit an Arbeitnehmern, deren Jobs nur wenig Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bieten. Menschen, die in Fabriken, Putzkolonnen oder auf Feldern im Akkord schuften, oder auch solche, die un- oder unterbezahlte Arbeit in der Kinderbetreuung oder häuslichen Pflege von Angehörigen verrichten.
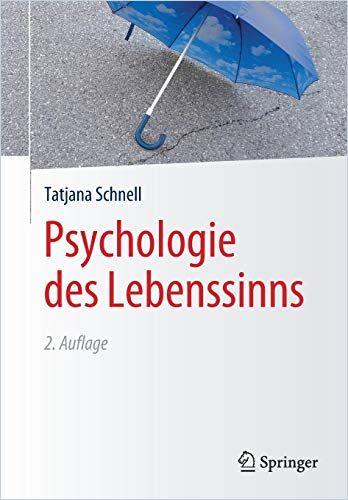
Hier kommt es vor allem darauf an, ganz konkret die Arbeitsbedingungen zu verbessern und auf diese Art Sinn zu stiften. Kein grün gewaschenes, aber folgenloses „We reimagine fashion for the good of all“ als Credo herausposaunen, sondern ganz greifbar und buchstäblich Sinn-voll: als Firma beschließen, nun existenzsichernde Löhne für Näherinnen in Bangladesch zu zahlen, die Einhaltung von Umweltauflagen in der Türkei ab sofort sicherzustellen und „Fast Fashion“ mit diesen und weiteren Maßnahmen den Kampf anzusagen.
Wir müssen klar differenzieren zwischen Arbeit, die Sinn stiftet, und sinnvoller Arbeit. Beinahe jede Arbeit ist per se sinnvoll und sollte dementsprechend gestaltet werden.
Tatjana Schnell
Wenn Helden der Arbeit im Fleischwolf landen
Menschen streben nach körperlichem und psychischem Wohlbefinden, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit. Wir möchten bleibende Werte schaffen oder, wie der Psychoanalytiker Erik H. Erikson es ausdrückte, „die Liebe in die Zukunft tragen“. Das können wir auch durch unsere Arbeit erreichen. Aber nicht nur. Anstatt mit der Suche nach einer sinnerfüllten Karriere die Latte unerreichbar hoch zu legen, suchen Sie ein paar Armlängen tiefer nach dem Machbaren:
- Ihren persönlichen Lebenssinn finden Sie nur bei sich selbst – nicht im noblen Purpose Ihres Arbeitgebers, in der nächsten Gehaltserhöhung, bei einer Reise um die Welt oder in Abhängigkeit zu anderen Menschen.
- Sinnvoll ist, was mit Ihren Werten übereinstimmt, was zu Ihren Talenten und Stärken passt und was Sie in einem bestimmten Moment als erfüllend empfinden.
- Je mehr unterschiedliche Identitäten und Ziele Sie verwirklichen, desto geringer ist die Gefahr, beim Wegbrechen einer Rolle in eine Sinnkrise zu geraten.
- Indem Sie sich selbst etwas Gutes tun, schaffen Sie kurze Glücksmomente; wenn Sie anderen Gutes tun, erfüllen Sie Ihr Leben mit Sinn.
- Ehrenamtliche Tätigkeiten und enge soziale Beziehungen machen deshalb langfristig glücklich und zufrieden.
- Individualistische Heilsversprechen nach dem Motto „Love it, change it or leave it“ verhindern gesellschaftlichen Wandel. Setzen Sie sich aktiv dafür ein, die Arbeits- und Lebensbedingungen für alle zu verbessern.
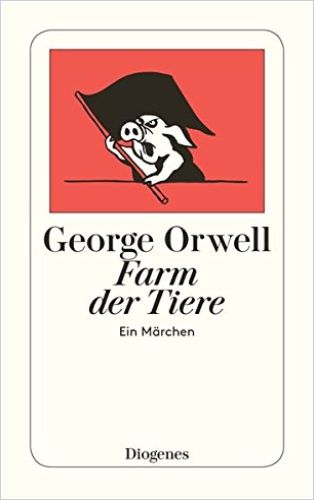
Wozu es führen kann, wenn sich Helden der Arbeit dem noblen Purpose anderer verschreiben, brachte George Orwell in Farm der Tiere gewohnt hellsichtig auf den Punkt: Boxer, die pferdgewordene Inkarnation des Sowjetmenschen Stachanow, ruft so lange „Ich will und werde noch härter arbeiten“, bis er vor Erschöpfung zusammenbricht. Zum Dank verscherbeln ihn die Genossen Schweine an den Pferdemetzger.