„Eine Macht wie die der Generation Z hat es auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch nie gegeben.“

Frau Lütkehaus, was ist eigentlich grundsätzlich mit dem Begriff „Generation“ gemeint?
Isabell Lütkehaus: 15 Geburtsjahrgänge werden heutzutage zu einer Generation zusammengefasst. Alle 15 Jahre spricht man daher von einer neuen Generation, der man einen bestimmten Namen gibt. Die Idee dahinter ist, dass die Umstände in Gesellschaft, Familien, Politik und Medien die Kindheit und Jugend eines Menschen prägen. Und dass darauf basierend Einstellung, Werte, Erfahrungen einer Gruppe von Menschen recht gleich sind.
Aktuell tummeln sich fünf Generationen in den Unternehmen. Was zeichnet die jeweilige Generation aus? Beginnen wir mit der Nachkriegsgeneration (geboren 1935 bis 1949).
Diese sind noch in der Zeit des Weltkrieges geboren bzw. kurz danach. Das bedeutet, sie haben die entbehrungsreichen Jahre nach dem Krieg erlebt. Sie wissen, wie sich Demütigung durch verlorenen Krieg, aber auch wie sich Befreiung anfühlt. Sie haben gesehen, dass man durch Leistung viele Dinge schaffen kann: das Wirtschaftswunder der Fünfzigerjahre. Sie sind sehr pflichtbewusst und Arbeit ist für sie nicht in erster Linie Sinnerfüllung. Arbeit ist Pflicht und dient dazu, sich Dinge leisten zu können. Auch der Familienbegriff wurde sehr eng gefasst. Offene Homosexualität oder dass eine Frau arbeiten ging, das gab es selten.
Dann folgten die Babyboomer (geboren 1950 bis 1964) und die Generation X (geboren 1965 bis 1979).
Ihre Eltern waren die Kriegsgeneration und sie wollten, dass es ihren Kindern besser ging als ihnen in der Kindheit. Sie wuchsen verglichen mit der Generation davor schon in materieller Fülle auf. Auch hier war das gesellschaftliche Leben noch sehr eng, aber es bildeten sich die ersten Individuen heraus. Denken wir an die Hippies oder auch außerparlamentarische Opposition. Die Babyboomer – zumindest ein Teil von ihnen – waren politisch sehr aktiv.
Andererseits war man sehr gesellig und kooperativ, weil man sich schon allein aufgrund der großen Zahl arrangieren musste.
Isabell Lütkehaus
Und dann kam die Generation X, meine Generation. Wir sind in Wohlstand aufgewachsen, waren eher unpolitisch und sind bis heute noch eher individuell angelegt und auch materiell. Marken waren wichtig und es kristallisierten sich immer mehr Gruppenbewegungen heraus. Die Popper, Punks, New Wave und auch die Ökos. Jeder machte so ein bisschen sein Ding und durfte das auch.
Take-aways:
- Wer Diversität im Unternehmen arbeitsteilig zu nutzen weiß, hat einen enormen Vorteil. Wer sie als Nachteil begreift, kämpft mit Reibungsverlusten und ungelösten Konflikten.
- Die Generation Z hat eine Macht auf dem Arbeitsmarkt, die es so in Deutschland noch nie gegeben hat.
- Beim Generationsmanagement kommt den Führungskräften die zentrale Aufgabe zu, den aktiven Austausch zwischen allen zu fördern und mit einer positiven Fehler- und Konfliktkultur einen Boden für Entwicklungen zu schaffen.
Womit wir dann bei der Generation Y (geboren 1980 bis 1994) und der Generation Z (geboren 1995 bis 2009) angekommen sind.
Die Generation Y sind die Kinder der Babyboomer. Sie wuchsen mit einem größeren Wunsch nach Individualität auf. Parallel wollte man jedoch auch gezielt Gruppen bilden, sodass diese Generation – auch dank Internet – sehr breit und international vernetzt ist. Das Internet brachte es auch mit sich, dass Menschen begannen, von überall zu arbeiten. Und hier kommen wir nun zur Generation Z. Diese wuchsen sehr bedürfnisorientiert auf, ihre Eltern boten ihnen in der Kindheit viele Wahlmöglichkeiten. Sie wurden bereits in frühen Jahren in Entscheidungen miteinbezogen. Viele von ihnen wurden als Kinder fremdbetreut, für sie ist es normal, dass Mann und Frau arbeiten. Gleichberechtigung ist für sie kein Thema mehr, sie ist vielmehr selbstverständlich. Diese Generation wundert sich vielmehr, warum Arbeitgeber, Regierung und Politik nicht mehr Möglichkeiten schaffen, um Familie und Beruf ideal zu vereinbaren. Was die Generation Z jedoch auch macht: Sie trennt wieder verstärkt zwischen Privatleben und Arbeit. Arbeit soll eine sinnvolle Beschäftigung sein, jedoch hat man nicht mehr eine so „familiäre“ Bindung zu einem Arbeitgeber. Freundschaften am Arbeitsplatz sind okay, müssen aber nicht zwingend sein. Und dies führt zu der Einstellungen, dass man eben geht, wenn es einem nicht mehr gefällt. Man fühlt sich nicht mehr so „verbunden“.

Man unterstellt der Generation Z ja genau deshalb gerne mal ein wenig Biedermeiertum.
Ja, es scheint eine gewisse Rückbesinnung auf Familie und Privatleben stattzufinden. Die persönliche Einstellung zum Thema Arbeit und Leistung wie auch Besitz und allgemein zum Leben hat aber auch viel mit Bildung und Herkunft zu tun. Wichtig in diesem Gesamtzusammenhang ist mir, dass der Generationsbegriff und die jeweilige Definition nicht zum Schubladendenken führen. Jeder Mensch hat ganz viele Facetten und die Generationszugehörigkeit ist nur ein Aspekt. Wenn Sie zum Beispiel als Flüchtling nach Deutschland kommen, haben Sie andere Bedürfnisse, als wenn Sie in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen sind.
Wenn nun diese fünf Generationen in einem Unternehmen, einer Organisation zusammentreffen, welche Vor- und welche Nachteile hat das?
Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass generationsgemischte Teams erfolgreicher sind als Teams, die nur eine Generation oder zwei abdecken. Umgekehrt sagen Menschen in Umfragen mit überwiegender Mehrheit: Ich möchte lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der mir ähnlich ist. Der mein Alter hat. Warum ist das so? Man fühlt sich verbundener und denkt, den anderen besser zu kennen. Man spricht eine gemeinsame Sprache und hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Zuerst würde man an dieser Stelle sagen, dass sich diese beiden Untersuchungen widersprechen. Doch das tun sie nicht.
Wenn Sie Diversität – wozu auch Sprache, Religion, Herkunft und Geschlecht zählen – arbeitsteilig nutzen, ist sie von Vorteil. Wenn Sie diese jedoch als Bedrohung ansehen, ist sie ein Nachteil, dann kann es zu Reibungsverlusten kommen.
Isabell Lütkehaus
Meine Generation war beispielsweise noch eher so geprägt, dass man mit den „Alten“ nicht so viel zu tun haben wollte. Die Generation Z hingegen sucht aktiv den Austausch mit den älteren Generationen. Wenn Sie es also schaffen, dass Sie die Stärken der jeweiligen Generation in den Fokus stellen und diese nutzen, ist das zum Vorteil aller im Unternehmen.
Die jüngeren Generationen sind ja oft digital sehr stark.
Genau. Meine Generation und die davor haben noch sehr viel Wissen angesammelt, Informationen zusammengetragen. Die jungen Generationen sehen Informationen jedoch heute nicht mehr als so wertvoll an. Sie sind ja überall verfügbar. Ich stelle immer wieder fest, dass sie eine ganz andere Herangehensweise haben, Dinge im Internet zu suchen. Sie sind dabei sehr schnell und effektiv. Die ältere Generation kann sie jedoch dabei unterstützen, die Informationen zu bewerten und zu filtern. Weil sie hier einfach viel mehr Erfahrung hat.
Sie sprachen die Konflikte gerade schon an. Oft spielen hier auch Vorurteile mit hinein, oder?
Das Gefühl der Zugehörigkeit habe ich automatisch zu Menschen, die mir ähnlich sind. Dieses Zugehörigkeitsgefühl birgt umgekehrt eine Ablehnung anderer in sich. Also In-Group ist meine Gruppe und Out-Group sind die, die anders sind. Und ich denke ja erst einmal, dass ich gut bin. Und das drückt den „anderen“ den Stempel „weniger gut“ auf. Wir alle kennen Stereotypen. Manche denken, die Jungen glotzen den ganzen Tag auf ihr Smartphone. Die sind faul und verwöhnt und können sich nicht konzentrieren. Wenn man dann zufällig auf einen jungen Menschen trifft, der sich an diesem Tag eben nicht so gut konzentrieren kann, fühlt man sich in seiner Annahme bestätigt. Man pauschalisiert und lehnt vielleicht basierend auf dieser Einstellung ab, mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu wollen.
Und so verstärken sich die Gräben. Es entstehen Untergruppen in einer Organisation, die nicht gut miteinander kommunizieren und kooperieren. Dies führt zunächst zu Reibungsverlusten und kann zu Konflikten heranwachsen.
Isabell Lütkehaus
Gleiches gilt auch bezogen auf Neid und Ängste. Die Annahmen „Die Jungen nehmen uns die Arbeit weg“ oder „Die Alten geben uns hier keine Chance“ führen nicht selten zu Diskriminierung.
Warum wird der Generation Z eigentlich so viel Macht und Stärke zugeordnet?
Sie wird ihnen nicht nur zugeordnet, sie haben diese Macht tatsächlich. Eine Macht wie die der Generation Z hat es auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch nie gegeben. Die Babyboomer gehen bis 2030 in Rente, meine Generation und alle nachfolgenden sind dank Pillenknick deutlich kleiner. Es ist also erst einmal eine rein demografische Entwicklung. Das heißt, viele Jungen können sich ihren Job aussuchen. Zudem sind sie nicht mehr so stetig wie früher. Man blieb meist dort, wo man anfing. Und das eben 30, 40 Jahre lang. Die jungen Menschen, die sich ihre Arbeitsplätze aussuchen können, gehen, wenn es ihnen an einem Ort nicht mehr gefällt. Aus diesem Grund sind sie es, die die Bedingungen stellen. Deswegen müssen Unternehmen, ob sie wollen oder nicht, umdenken, wenn sie gute Fachkräfte, gute Mitarbeitende, Auszubildende bekommen und halten wollen.
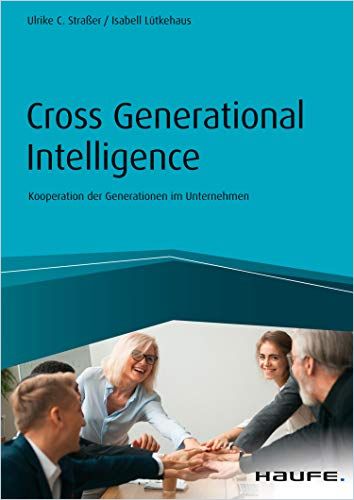
Darum geht es auch in Ihrem Buch „Cross Generational Intelligence“. Was ist mit diesem Konzept, dieser Methode gemeint?
Cross Generational Intelligence ist eine Haltung, die durch Offenheit, Konstruktivität und Lösungsorientierung geprägt ist. Und es ist gleichzeitig eine Kompetenz von Organisationen, generationsintelligent zu handeln. Es geht hier vor allem um die Intelligenz von Führungskräften, die lernen, mehrere Generationen so zu führen, dass alle zufrieden sind. Dass die Älteren eingebunden bleiben und die Jungen Beachtung finden. Es ist aber auch Teamkompetenz: Wie arbeiten wir als Team optimal und erfolgreich zusammen, wenn wir mehrere Generationen abbilden?
Und wie implementiere ich als Unternehmen diese Haltung, diese Kompetenz in einem Unternehmen?
Hier haben die Führungskräfte eine wichtige Rolle. Diese müssen lernen, ihre Teams ideal arbeitsteilig zusammenzubringen. Hier hilft eine positive Fehlerkultur, diese muss jedoch von ganz oben gelebt werden. Ebenso braucht es eine konstruktive Konfliktkultur. Das bedeutet, der Generationskonflikt darf nicht geleugnet und hierarchisch entschieden, sondern muss konstruktiv genutzt werden. In meiner Arbeit als Mediatorin unterstütze ich Führungskräfte dabei, dies zu erlernen. Es geht darum, als lernende Organisation eine Generationsintelligenz zu entwickeln.
Was mache ich, wenn meine Mitarbeitenden nicht mitspielen?
Sie müssen den Menschen erklären, warum es wichtig ist. Und gleichzeitig müssen Sie für Verständnis sorgen. Vielleicht sind die Ideen der anderen Generation ja gar nicht so falsch? Auch wenn ich meine eigenen habe. Was ist denn zum Beispiel so schlecht daran, wie die junge Generation es tut, den Sinn von Arbeit zu hinterfragen?
Ich persönlich finde es toll, dass junge Menschen Unternehmen dazu zwingen, nachhaltig zu sein und zu akzeptieren, dass man Familie und Beruf im Leben vereinbaren will.
Isabell Lütkehaus
Ein Autorenkollege nennt die Generation Z daher auch Z wie Zombie. Denn sie stellen ansteckende Forderungen, die allen im Unternehmen zugute kommen können. Auf der anderen Seite werden Sie dennoch Menschen in Ihrem Unternehmen haben, die darauf keine Lust (mehr) haben. Einige zählen schon die Tage bis zur Rente. Hier ist es für Sie als Führungskraft wichtig, die Teams gut zusammenzubringen. Die Babyboomer haben oft wegen ihrer Geselligkeit etwas Väter- oder Mütterliches. Die können die Jungen gut unter die „Fittiche“ nehmen, zum Beispiel in Form von Mentoringprogrammen. Privat kommen die Generationen besser denn je miteinander aus. Viele junge Menschen sind sehr eng mit ihren Großeltern, es findet ganz viel Austausch statt. Warum können wir das also im Beruflichen nicht auch umsetzen?
In ihren Generationsworkshops machen Sie genau das, oder? Sie bringen die Menschen zusammen.
Wir stellen immer wieder fest, dass sobald sich die Individuen austauschen, sich Vorurteile und Konflikte auflösen. Daher fördern wir zu Beginn mit einem spielerischen Setting zunächst einmal den Austausch. Oft standen sich bis dahin Gruppen gegenüber – die Alten und die Jungen. Nun befindet sich der Ältere mit dem Jüngeren in einem direkten, persönlichen Austausch. Und das bewirkt viel. Dafür stellen sich die Generationen zu Beginn des Workshops vor und erhalten dann Aufgaben, die sie arbeitsteilig lösen. Anschließend wird die Zusammenarbeit gemeinsam reflektiert.

Der aktive Austausch miteinander ist demnach das A und O?
Früher hat der Chef gesagt, wo es hingeht, und man hat das gemacht und die Klappe gehalten. Ob der Mitarbeiter es gut fand oder nicht, interessierte häufig nicht. Das hat sich geändert. Unternehmen erkennen ihre Mitarbeitenden mittlerweile als ihre wertvollsten Ressourcen an. Die haben tolle Ideen, Ideen, die dem Unternehmen nutzen können. Vor allem auch bezogen auf Digitalisierung und Globalisierung. Und das gilt auch für die Älteren. Früher waren Sie mit 50 Jahren nicht mehr vermittelbar. Heute werden Menschen aus der Rente zurückgeholt, weil sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung eine wertvolle Ressource sind.
Wir sprachen schon davon, dass die Älteren auch viel von den Jüngeren lernen können. Wie kann dieser Wissenstransfer gefördert werden?
Heute gibt es auch Reverse Mentoring, also nicht der junge lernt vom älteren Menschen, sondern umgekehrt. Ich erlebe diesen Austausch übrigens immer sehr höflich und respektvoll. Junge Menschen haben gelernt, dass sowohl Mama als auch Papa beruflich etwas leisten. Und dieses Wertschätzende den Eltern und auch Großeltern gegenüber bringen junge Menschen auch mit ins Unternehmen. Miteinander und voneinander lernen – und das auf Augenhöhe –, das ist eine Chance für alle Generationen.
Stichwort Wissensmanagement allgemein – auch das gehört sicher zur Cross Generational Intelligence dazu?
Einige Zeit lang hat man geschaut, dass man die Alten loswird. Nun hat ein Umdenken stattgefunden und man holt sie wieder zurück. Man lässt sie nicht mehr einfach ziehen, sondern versucht, das Wissen im Unternehmen zu halten. Viele Ältere haben ihr Wissen nicht digitalisiert. Das ist in ihrem Kopf oder auf Karteikarten. Und das ist schwer zu transportieren. Oft findet leider immer noch keine Übergabe statt. Der eine geht und der andere kommt erst Wochen später und beginnt bei null. Onboarding und Offboarding samt Wissensmanagement werden immer wichtiger. Einige bleiben auch nach der Pensionierung einem Unternehmen noch als freier Berater erhalten, auch das ist eine Lösung. Damit das mit dem Wissenstransfer jedoch gelingt, braucht es jemanden, der das Wissensmanagement betreibt. Das kann zum Beispiel jemand im HR sein.
Fünf Generationen bedeutet auch, dass die Ansprüche ans Gesundheitsmanagement wichtiger geworden sind. Was und wer unterstützt hier, dass es den unterschiedlichen Ansprüchen aller gerecht werden kann?
Für das betriebliche Gesundheitsmanagement ist das Thema Generation in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens machen Konflikte krank. Stimmt die Atmosphäre nicht, schwelen Konflikte, belasten die Menschen dauerhaft, mit gesundheitlichen Folgen. Und das führt zu Ausfällen, die oft sehr lange andauern können. Konfliktmanagement ist daher Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements, das wissen aber viele Unternehmen nicht. Sie ignorieren Konflikte und es kommt entweder zu offener Eskalation oder verdeckter Vermeidung in der Zusammenarbeit. Und zweitens geht es natürlich auch um Gesundheit und Vorsorge im klassischen Sinn. Wie hoch ist der Schreibtisch und wo steht der Bildschirm? Da haben die Jungen meistens noch nicht so hohe Bedürfnisse. Gesundheitlichen Schaden wollen sie aber auch nicht nehmen. Angebote wie Yogakurse, gesundes Essen und klare Arbeitszeiten sind ihnen wichtig. Es geht also weniger um direkt körperliche Gesundheit, sondern eher um psychische und das Leben beeinflussende Dinge, wie zum Beispiel eine gute Work-Life-Balance.
Über die Autorin
Isabell Lütkehaus arbeitet als Mediatorin, Supervisorin, Coachin und Trainerin. Neben Cross Generational Intelligence hat sie unter anderem die folgenden Bücher geschrieben: Basiswissen Mediation: Handbuch für Praxis und Ausbildung, Umgang im Wechselmodell: Eine Familie, zwei Zuhause: Gleichberechtigte Eltern bleiben nach Trennung und Scheidung und Generationenmanagement in Arzt- und Zahnarztpraxis: Von Jung bis Alt ein starkes Team.







