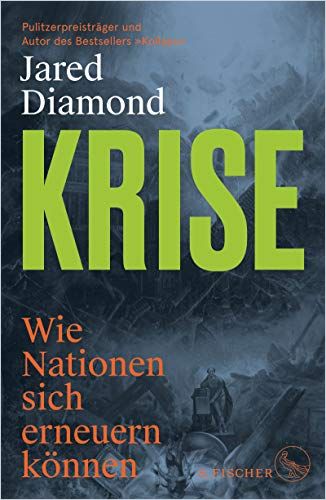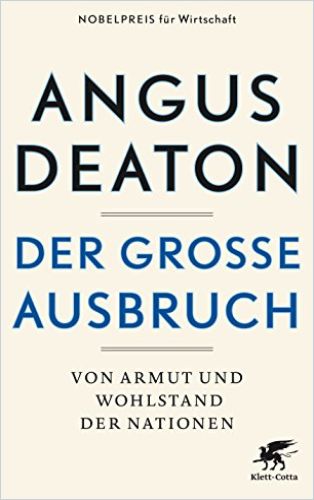Stromschnellen im Fluss

Die meisten Menschen haben für ihr Leben das innere Bild eines möglichst langen, ruhigen Flusses, in dem Turbulenzen die Ausnahme sind. Der Krise kommt in dieser Vorstellung der Charakter des Besonderen zu. Sie ist eine Stromschnelle, die – um im Bild zu bleiben – möglichst zu umschiffen ist. Danach fließt das Wasser wieder ruhig und harmonisch.
Ein trügerisches Bild, wie gerade gegenwärtig wieder deutlich wird. Wir leben in einer Dauerkrise. Finanzkrise, Immobilienkrise, Dieselkrise, Coronakrise, Rohstoffkrise, Ukrainekrise. Auch Fachkräftekrise: Man kriegt ja heute keinen Heizungsinstallateur mehr, aber jede Menge Klangschalentherapeuten. In vielen Unternehmen gehören deshalb Verunsicherung, Frustration und aufgeheizte Gemüter zum Betriebsklima. Dort geht es auch gar nicht mehr um die Frage: „Wann ist die Krise vorbei?“, sondern „Wie gehen wir mit der Dauerkrise um?“
Krise und „Normalität“
Aber was ist das eigentlich: eine Krise? Eine Unterbrechung des Normalzustands, zweifellos, des Erwartbaren, der Sicherheit. Aber ist das nur ein Betriebsunfall, nach dem alles wieder zurück zum Zustand vor der Krise kommt? Oder ist es der Übergang von einer bestimmten Ordnung zu einer anderen; ein Übergang, bei dem die Zeit ihr Wesen zu verändern scheint?
Eine substanzielle Antwort hängt ab von der Konzeption dessen, was wir „normal“ nennen. Die ist an historische Perspektiven gebunden. Man lese die Zeitungen der 1920er- und 1930er-Jahre – Dauerkrise in allen Lebensbereichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber lebten wir in einer beispiellosen Zeit der Nicht-Normalität. Wirtschaftlich und gesellschaftlich war alles nur aufsteigender Linie, alles wurde immer besser und wohlhabender.
Wer zum Beispiel als deutscher Mann kurz nach 1945 geboren wurde (so wie ich), hatte in der Glückslotterie des Lebens das große Los gezogen – zuvor wäre er schon zigmal füsiliert worden.
Diese goldene Nicht-Normalität ist uns aber zur Normalität geworden! Wir erwarten von ihr Stetigkeit, als hätten wir Anspruch auf sie. Und sie hat uns – aufs Ganze gesehen – träge gemacht. Das Wahrnehmen der Krise ist damit selbst die Krise – eine Krise der Urteilskraft. Weil unserer Epoche die Genauigkeit der historischen Einstufung fehlt.
Das können wir mit Blick auf Führung konkretisieren. Aus anthropologischer Sicht brauchen wir Führung nur in Krisen. Nicht alles ist vorhersehbar, nicht alles kann organisiert werden, nicht alles läuft konfliktfrei und reibungslos. Führung ist insofern Lückenbüßer für alles, was im Unternehmen nicht von selbstlaufenden Prozessen erledigt wird. Auf dem Schreibtisch des amerikanischen Präsidenten steht ein kleiner, in Granit gemeißelter Satz: „The buck stops here“ – etwa: Bis hierhin kann man den Schwarzen Peter schieben, nicht weiter.
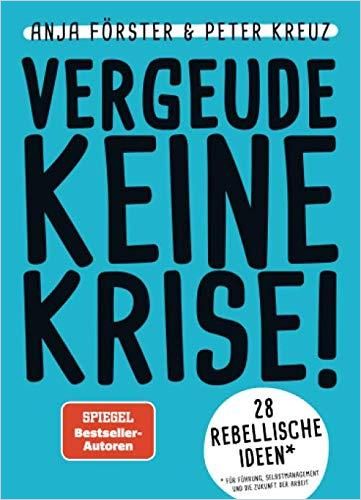
Führung wird also erst dann wertvoll, wenn Routinen versagen. Ein Unternehmen braucht keine Führung, wenn es in ruhigen Gewässern segelt. Ich will es zuspitzen:
In den letzten Jahrzehnten war Führung meistens überflüssig; gutes Managementhandwerk reichte bei schönem Wetter aus. Heute aber muss Führung die Krise als ihren Normalzustand begreifen.
Konkret bedeutet das: Es ist nicht so, dass sich Führungskräfte bei der Bewältigung ihrer Aufgabe mit Krisen konfrontiert sehen. Vielmehr wird die Führungsaufgabe durch Krisen überhaupt erst geschaffen. Aus Sicht der Führungsnotwendigkeit ist die dauerkriselnde Gegenwart also „normal“ – und eben keine Krise. Sondern ihre Existenzvoraussetzung. Wer das nicht verstanden hat, sollte sich nach einer anderen Aufgabe umsehen.
Gefragtes Führungsbewusstsein
Woraus sich die Frage nach der Qualität des Bewusstseins ergibt. Bin ich Opfer? Oder bin ich Gestalter? Freue ich mich über das Abenteuer, die Chancen, die Neubewertungen? Oder rufe ich nach einer schützenden Zentralinstanz, die mir Wellnessführung garantiert?
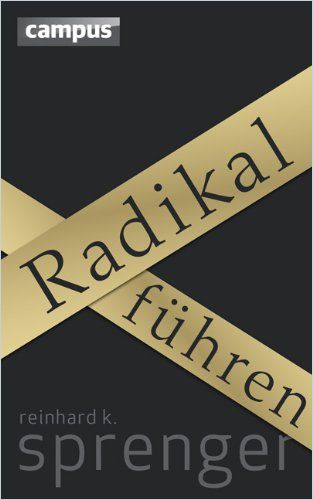
Im Institutionellen brauchen wir mehr Flexibilität, mehr Ausspülen dessen, was sich sklerotisch in den letzten 30 Managementjahren abgelagert hat. Im Individuellen brauchen wir mehr Entscheidungsbereitschaft – in zukunftsfreudiger Erwartung des Nicht-immer-weiter-so. Und vor allem das Aufgeben der Hoffnung, es würde noch mal wie früher.
Wer von der guten alten Zeit träumt, hat nur ein schlechtes Gedächtnis.
Der Fluss, die Stromschnellen, das Mitfließen – oder das Festhaltenwollen: In meinem Song „Das Ufer“ klingt einiges davon an.
Song
Hier können Sie das Album „Sprenger 5“ bestellen.
Songtext
Das Ufer
Wir war’n zu sehr mit dem Ufer beschäftigt
Dabei gab’s nur den Fluss
Wir war’n beim Schicksal vetoberechtigt
Dass nichts so kommen muss
Halten auf und halten fest
Wir halten bis zum Schluss
Halten an und halten fest
Dabei gab es nur den Fluss
Wir haben die Ränder und Deiche befestigt
Vor drohendem Verlust
Wir war’n mit Ankern vollbeschäftigt
Das harte Wort: Du musst!
Halten auf und halten fest
Wir halten bis zu Schluss
Halten an und halten fest
Dabei gab es nur den Fluss
Nächste Schritte
Bestellen Sie das Album „Wenn der Wind sich hebt“ und „Sprenger 5“ von SPRENGER Die Band hier. Wer Autor und Band für einen unvergesslichen Live-Event buchen will, erreicht das Management hier. Und hier finden Sie alle Kolumnen von Reinhard K. Sprenger.