Mit Neurowissenschaft zu mehr Produktivität

Wie sich das Thema Homeoffice auf die eigene Produktivität auswirkt, lässt sich nicht allgemein sagen. Aber es scheint Tendenzen zu geben: Eine repräsentative Studie der Universität Leipzig, die 1000 deutsche Arbeitnehmer über zwei Jahre – und die Coronapandemie – hinweg beobachtet hat, kommt zu einem klaren Ergebnis: Mit Covid, Lockdown und dem Abwandern ganzer Belegschaften ins Homeoffice nahm die Produktivität der Befragten signifikant ab – jedenfalls, wenn man sie nach ihrer eigenen Einschätzung fragt.
Die flexible Arbeit im Homeoffice hat jedoch viele Vorteile und wird wohl auch künftig ein Teil der neuen Arbeitswelt bleiben. Eine Studie aus Stanford belegt zudem, dass Beschäftigte im Homeoffice länger arbeiten, seltener krank sind und weniger Urlaub nehmen. Und auch ein Großteil der Arbeitgeber glaubt an ein produktives Arbeiten zu Hause, wie eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung herausfand. Wie also passt das zu den Ergebnissen der Studie aus Leipzig?
Unsere Produktivität scheint in Ordnung zu sein – aber wir fühlen uns weniger produktiv.
Ob diese Selbsteinschätzung mit der tatsächlichen Leistung übereinstimmt, ist erst mal zweitrangig; denn dass man sich zufriedener fühlt und bessere Arbeit leistet, wenn man selbst auch das Gefühl hat, produktiv zu sein, steht wohl außer Frage. Das Bedürfnis nach einer produktiveren Art zu arbeiten ist also da, und viel davon ist Kopfsache. Das erklärt, warum man in der zeitgenössischen Ratgeberliteratur immer häufiger das Stichwort „Neurowissenschaft“ findet: Die Hirnforschung hat überraschend viele gute Antworten auf klassische Fragen zur Produktivität. Wir haben die spannendsten Erkenntnisse für Sie herausgesucht:
1. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft!
Was auf den ersten Blick nichts mit Produktivität zu tun zu haben scheint, erweist sich als eine überaus interessante Erkenntnis, die zwei Wissenschaftler aus Stanford gewonnen haben:
Wenn wir uns einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, sind wir sehr viel leistungsfähiger und motivierter, weil wir dann auch gerne Zeit für entsprechende Aufgaben investieren.
Und das ist noch nicht alles: Der Psychologe Oscar Ybarra fand heraus, dass sogar unser IQ durch soziale Interaktionen messbar gesteigert werden kann. Nach einer nur zehnminütigen Diskussion erzielten Menschen in bestimmten IQ-Tests bereits deutlich bessere Ergebnisse als solche, die zuvor zehn Minuten lang – Achtung! – fernsehen durften. Ein interessanter Anstoß auch für Unternehmen, die sich fragen, warum sie sich um das Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitarbeiter bemühen sollten.

Take-aways:
- Gute Beziehungen wirken sich positiv auf die Lebenserwartung und das Wohlbefinden aus.
- Wenn Menschen sich als Teil einer Gemeinschaft empfinden, sind sie leistungsbereiter.
- Im Unterschied zu Mitleid belastet Mitgefühl nicht, sondern befähigt uns, zu helfen.
2. Vermeiden Sie Multitasking!
Wer versucht, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, hat meist die besten Intentionen. Doch so speditiv das auch klingt oder aussieht, die Neurowissenschaft sagt eindeutig: Lassen Sie’s einfach!
Multitasking ist nicht nur ineffektiv, weil wir unterbewusst immer bei anderen Aufgaben sind und uns so gar nicht mehr richtig auf aktuelle oder gar künftige Tätigkeiten konzentrieren können. Es ist sogar gefährlich.
Die ständigen schnellen Belohnungen in Form von Dopaminschüben, die wir durch Ablenkungen erlangen, und die mangelnde kognitive Kapazität unseres Gehirns, weil es ständig an anderen, immer neuen Aufgaben arbeitet, führen zu einer Art selbst verschuldetem AD(H)S. Üben Sie sich also darin, Pausen einzulegen, To-do-Listen zu schreiben und sich lediglich auf Ihre aktuelle Tätigkeit zu konzentrieren – und darauf, warum sie wichtig ist.
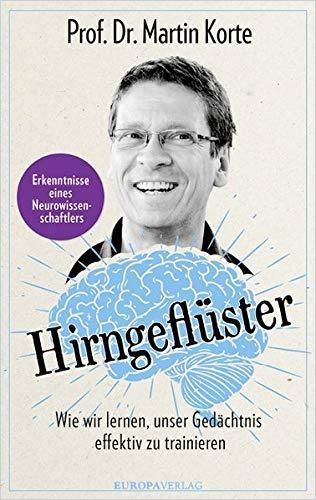
Take-aways:
- Multitasking ist ineffektiv bis schädlich. Arbeiten Sie lieber eine Aufgabe nach der anderen ab.
- Kognitive Fähigkeiten verkümmern, wenn man sie nicht pflegt.
- Es ist ein Mythos, dass wir nur zehn Prozent unseres Gehirns nutzen.
3. Sagen Sie Ihrer Zerstreuungssucht den Kampf an!
Dass wir uns so leicht zu anderen Dingen als denen, die wir gerade ernsthaft tun, hinreißen lassen, liegt daran, dass Dopamin, im Volksmund auch „Glückshormon“ genannt, mit der Zeit bereits dann ausgeschüttet wird, wenn wir antizipieren, eine angenehme Ablenkung zu erleben – also etwa, wenn wir auf unser Smartphone schauen und denken, dass es da etwas Interessantes zu entdecken gibt. So geraten wir immer wieder in eine Art Zerstreuungssucht. Dabei sind wir nicht nur süchtig nach den üblichen Verdächtigen, also den sozialen Medien, Newsseiten oder E-Mails vom attraktiven Tennislehrer, sondern auch nach Dingen wie Tagträumen oder Grübeln – dass das alles gleichermaßen Gift für produktives Arbeiten ist, wissen Sie wahrscheinlich.
Neben diesen eher überraschenden „Drogen“ listet der Neurowissenschaftler Judson Brewer übrigens noch weitere auf, etwa Liebe oder Anerkennung – und zeigt, wie wir sie durch Achtsamkeit und die Unterbrechung unseres erlernten Suchtverhaltens überwinden.
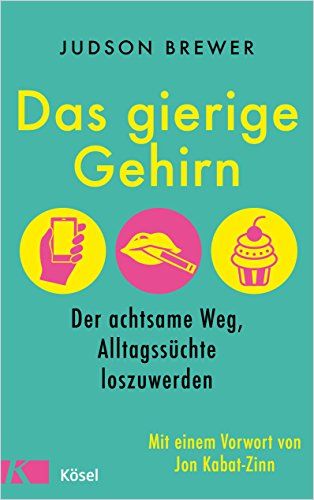
Take-aways:
- Eine Sucht ist etwas, das wir tun, obwohl wir wissen, dass es uns schadet.
- Wir können auch süchtig sein nach Anerkennung, Liebe, Denken, Tagträumen und nach uns selbst.
- Mit dem buddhistischen Prinzip der Achtsamkeit lassen sich alle diese Süchte auflösen.
4. Machen Sie öfter mal was Neues!
Oft wird erzählt, mit speziellen Übungen, dem sogenannten Hirnjogging, ließe sich die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Aber da müssen wir Sie enttäuschen, denn damit werden bloß einzelne Hirnfunktionen und -abläufe trainiert, die Sie ohnehin schon beherrschen. Mit diesem sowie weiteren Mythen rund um das Gehirn räumt der Neurobiologe Henning Beck auf. Diese Aufklärungsarbeit ist besonders wertvoll, wenn man wissen möchte, was man wirklich tun kann, um langfristig produktiver zu werden.
Das tut man etwa, wenn man Musik macht, Sport treibt oder kocht – das Hirn also mit Dingen herausfordert, die man nicht ständig macht. Oder aber, Sie stellen sich immer wieder neuen Herausforderungen auch jenseits der Küche:
Besteigen Sie einen Berg! Bauen Sie ein Baumhaus! Telefonieren Sie mal wieder mit Ihrer Mutter! Das hinterlässt bleibende Wirkung: Stellen Sie sich regelmäßig neuen Herausforderungen, stehen die Chancen gut, dass Sie das damit Trainierte auch noch im hohen Alter beherrschen. Dann also, wenn Ihre Kinder Sie mal wieder anrufen.
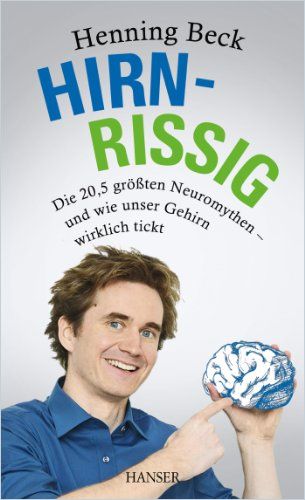
Take-aways:
- Ständige Neugier auf die Herausforderungen des Lebens ist das beste Gehirntraining.
- Über die Leistungsfähigkeit des Gehirns entscheidet nicht die Größe, sondern die Effizienz der neuronalen Vernetzung.
- Auch im Alter kann das Gehirn so gut lernen wie in jungen Jahren.
Weitere spannende Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft finden Sie hier:








