Ausweitung der Kampfzone

Ich bitte um Nachsicht, dass ich ein Thema aufgreife, welches der allgemeine Moralisierungsfuror zum gesellschaftlichen Dauerkonflikt gemacht hat. Viele Unternehmen haben das „Gendern“ der Sprache zum Tugendnachweis erhoben: „Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“, avancierter: „Liebe Mitarbeitende!“ – so, als würden sie gerade mal vorübergehend dabei sein. Manche, wie die SwissRe, verboten ihren weltweit 15.000 Angestellten ab 2019 gar die Verwendung von Wörtern wie „Mann“ und „Frau“. Andere diktieren in allen Veröffentlichungen das Gendersternchen.
Diese Firmen begreifen, erstens, nicht (oder wollen nicht begreifen), dass eine biologische Kategorie nichts zu tun hat mit einer grammatischen Kategorie. Sexus und Genus darf man nicht verwechseln. Sonst wäre es kaum verständlich, dass im Deutschen alle Pluralbildungen „weiblich“ sind. Oder dass ein Auto „der BMW“ heißt, aber ein Motorrad „die BMW“. Wenn ich zum „Bäcker“ gehe, hat niemand etwas dagegen, wenn eine Bäckerin das Brot gebacken hat. Und wo steht eigentlich geschrieben, dass die Hose männlich und der Rock weiblich sei?
Ich kann verstehen, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts Aufwertung einklagen. Aber die Sprache kann das nicht leisten. Sie verteilt kein Recht auf Mitgemeintwerden. Und ich bezweifle stark, ob die Sprache die behauptete kulturelle Dominanz des Männlichen ausgleichen kann. Früher wurden nur Männer Ärzte – nur weil man sagte „Ich gehe zum Arzt“, auch wenn es eine Ärztin war? Auch heute geht man noch zum „Arzt“. Aber die große Mehrheit der Medizinstudenten ist längst weiblich. Haben die sich abschrecken lassen?
Es ist einfach nicht wahr, dass Sprache geschlechtsspezifisches Bewusstsein präjudiziere.
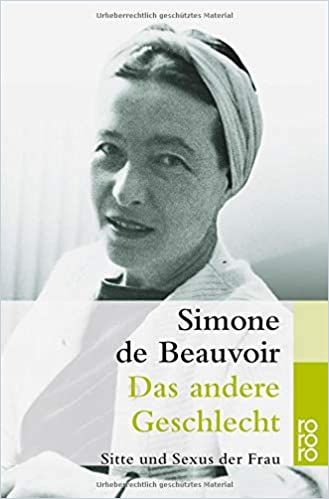
Das tut sie weltweit in keiner Sprache. Ich fühle mich als Mann ja auch immer „mitgemeint“, wenn es „die Führungskraft“ heißt. Ich fühle mich auch als „der Manager“ oder als „der Vorgesetzte“ nicht in meiner Männlichkeit angesprochen. Sondern schlicht als Mensch.
Insofern ist diese Sexualisierung, zweitens, eine missbräuchliche Anbiederung an eine (akademische) Minderheit, die der gesamten Gesellschaft ihren Benachteiligungsdiskurs aufdrückt: Im September 2022 gaben ganze 16 Prozent der Befragten einer repräsentativen infratest dimap-Umfrage im Auftrag des WDR an, das Thema gendergerechte Sprache für sehr wichtig zu halten – 41 Prozent hingegen hielten es für irrelevant.
Hier werden also Probleme ‚gelöst‘, die außerhalb einzelner Empfindlichkeitsenklaven niemand hat.
Steffen Mau, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin, untersucht seit Jahren solche „Triggerpunkte“ (dazu gehören neben dem Gendern auch das Thema „Cancel Culture“ oder Aktionen sogenannter „Klimakleber“), und nennt sie radikalisierte Formen politischer Kommunikation, „die von zahlenmäßig meist eher kleinen Akteursgruppen an den Rändern der Konfliktarenen ausgehen, die sich aber aufgrund ihrer Lautstärke und Zuspitzung besonders gut in die Aufmerksamkeitsökonomie der Medien einfügen“. Und, möchte man anfügen, damit sehr erfolgreich sind.
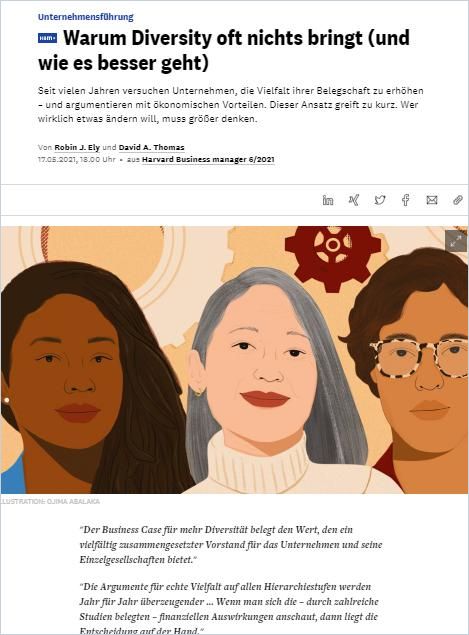
Warum Diversity oft nichts bringt (und wie es besser geht)
Harvard Business ManagerBeim Gendern wird das Ganze mitunter zum Übergriff auf ein Bürgerrecht – nämlich das Deutsche ohne Gängelei zu verwenden. Und wo die Selbstverständlichkeit der Sprachverwendung und der Wille zur Verständigung, der aller Sprache vorausgesetzt ist, derart infrage gestellt ist, etablieren sich nicht weniger Grenzen und symbolische Trennungen, sondern immer neue. Das sabotiert auf kuriose Weise die Interessen der Initianten solcher Unterfangen: Es ist unintelligent, ständig an den Unterschied zu erinnern, den man überwinden will.
Drittens: Die Endung „-er“ bezeichnet im Deutschen eine Rolle. Sie macht aus einem Menschen, der mitarbeitet, einen Mitarbeiter. Sie bezeichnet kein biologisches Geschlecht.
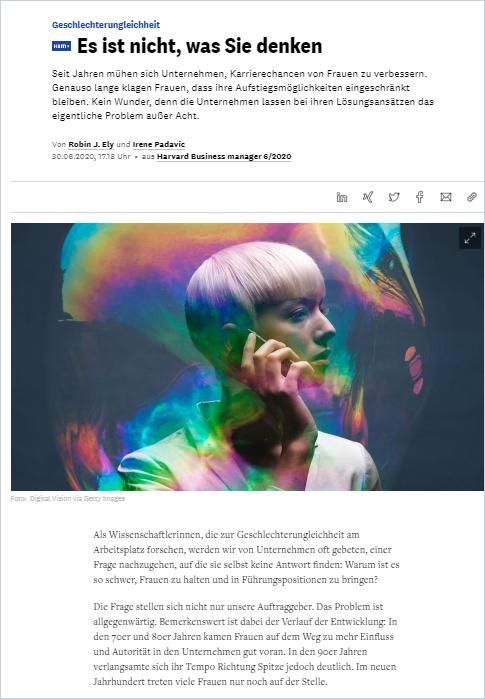
Es ist nicht, was Sie denken
Harvard Business ManagerDas generische Maskulinum setzt also keineswegs Mensch und Mann gleich, schon gar nicht diskriminiert es Frauen.
Es ist vielmehr umgekehrt: Mit „Mitarbeiter“ ist nur eine soziale Rolle bezeichnet. Mit „Mitarbeiterin“ hingegen ist eine Funktion plus Geschlecht genannt. Die Doppelnennung „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, gesellschaftlich übrigens schon viel akzeptierter, politisiert und sexualisiert bereits die Lebenswelt. Als würde das Geschlecht beim Mitarbeiten eine primäre Rolle spielen. Nicht das Gemeinsame wird dadurch betont, sondern ein Kulturkampf zwischen Männern und Frauen.
Das verweist auf eine gefährliche Tendenz in unseren Unternehmen:
Es machen sich Mikroideologen breit, die die Mitarbeiter in Bevorzugungs- und Benachteiligungsgruppen spalten.
Das führt nicht nur dazu, dass viele Unternehmensstrukturen endlos erweitert und differenziert werden. Der Fokus auf Gruppenidentität bedroht auch die Einheit des Unternehmens. Im Unternehmen steht dann nicht mehr das Verbindende im Mittelpunkt, sondern das Trennende.
Dieser Ausweitung der Kampfzone sollten wir entschlossen entgegentreten. Passen wir auf, dass wir nicht nur noch Bäume sehen – und keine Wälder mehr. Und hoffen wir mit Johann Gottfried Herder: Es sei ein Glück, „dass das Reich einer lebendigen Sprache Demokratie ist; das Volk regiert, und duldet keine Tyrannen: der Sprachgebrauch herrscht und ist schwer zu bändigen.“
Nächste Schritte
Bestellen Sie Reinhard K. Sprengers neues Buch hier. Wer den Autor für einen Live-Event buchen will, erreicht das Management hier. Und hier finden Sie alle seine getAbstract-Kolumnen seit 2020.







