„Was ist die häufigste erste Reaktion auf einen Disruptor? Es ist Gelächter.“

Herr Keese, alle reden von der digitalen Revolution, der digitalen Transformation. Doch was genau damit gemeint ist, da scheiden sich die Geister. Was verstehen Sie persönlich darunter?
Christoph Keese: In der Hauptsache geht es hier um Geschäftsmodelle und Technologie. Die Technologie verändert sich und zieht eine Geschäftsmodell-Revolution nach sich. Die großen Umbrüche, die wir in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren gesehen haben, sind in der Hauptsache solche Geschäftsmodell-Revolutionen. Wenn man den Umbruch auf „Digitalisierung“ verkürzt, besteht immer die Gefahr, dass betroffene Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen: Digitalisierung haben wir doch schon! Die haben gerade von Fax auf E-Mail umgestellt, und vergessen darüber dann gern, dass der wahre disruptive Druck erst durch die Geschäftsmodell-Transformationen – auf Basis neuartiger Technologien – entsteht.
In vielen Unternehmen werden Digitalisierung und die digitale Transformation also weiterhin synonym gebraucht.
Richtig. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn man Digitalisierung versteht als die „Digitalisierung bestehender Prozesse“, dann bedeutet das, dass Sie eine Automobilfabrik so umrüsten, dass in die bestehenden Maschinen neue Sensoren implementiert werden. Diese Sensoren werden über das Internet of Things (IoT) miteinander verknüpft und so kommt die sogenannte „Predictive Maintenance“ zum Einsatz: Wenn nun eine Welle unwuchtig läuft, kommt der Handwerker und tauscht die Welle aus, noch bevor die Maschine überhaupt jemals stehen geblieben ist. Dadurch kommt es zu weniger überraschenden Bandausfällen, was wunderbar ist. Allerdings: Was, wenn es keinen Sinn mehr macht, diese Autos zu bauen? Und was, wenn es keinen Sinn mehr macht, diese Autos nach dem althergebrachten Modell zu bauen?
Innovation ist eben nicht gleich Innovation, meinen Sie?
Genau. Nach Clayton Christensen, der das Wort „Disruption“ in die Wirtschaftssprache eingeführt hat, gibt es zwei Arten von Innovationen. Einerseits ist es die erhaltende Innovation, von der im obigen Beispiel die Rede ist. Andererseits gibt es aber auch die disruptive Innovation.
Die erhaltende Innovation ist kein bisschen weniger innovativ als die disruptive, sie unterscheidet sich von der disruptiven Innovation bloß dadurch, dass das Geschäftsmodell erhalten bleibt.
In unserem Beispiel der Automobilfabrik wird durch die Weiterentwicklung der Produktionsstraße effizienter produziert. Das Geschäftsmodell aber bleibt das gleiche: Das Auto wird produziert. Der Käufer kauft es, der Käufer besitzt und fährt es. Im Gegensatz dazu ist ein neues Geschäftsmodell eine disruptive Innovation. Tesla, als der Hauptangreifer der traditionellen deutschen Autoindustrie, bietet auf der einen Seite tatsächlich erhaltende Innovationen: Die Firma unterhält sehr moderne Fabriken, die hoch automatisiert sind, natürlich viel IoT einsetzen. Auf der anderen Seite aber bieten sie auch disruptive Innovationen. So gehört zum Geschäftsmodell auch das Angebot von Ladestellen, was die Verwertungskette verlängert: Mit meinem Tesla „tanke“ ich am Tesla-Supercharger, wo ich nur 20 Minuten warten muss. Kürzlich hat Tesla sogar angekündigt, dass sie Restaurants bauen werden und Sie während des Ladens am Tesla-Supercharger nun auch einen Tesla-Kaffee trinken können. Das sind disruptive Innovationen, die ganze Märkte umkrempeln können. Carsharing ist – jenseits der Herstellerfrage – auch so eine: Das Auto, das ich fahre, muss ich nicht mehr besitzen. Das spart Geld, Nerven und Platz, macht Sie jenseits Ihres Wohnorts auch flexibler, jedenfalls, wenn Sie nicht auf das Statussymbol Auto stehen.
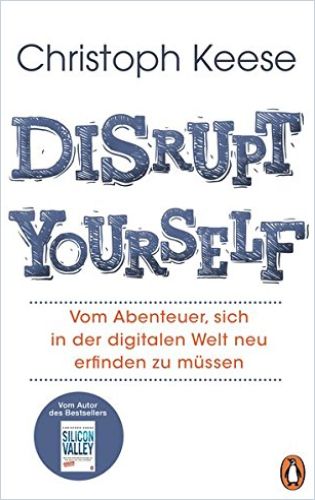
Mit dem Bau von Cafés oder Restaurants torpediert Tesla außerdem nicht nur ein bestehendes Geschäftsmodell, sondern gleich mehrere. Hier wird versucht, alle mit einem Produkt verbundenen Services unter einem Dach zusammenzubringen. Ist das ein Erkennungsmerkmal disruptiver Innovation?
Disruptoren torpedieren tatsächlich oft mehrere Geschäftsmodelle gleichzeitig. Das bekannteste Beispiel dafür ist Apple: Seit der Erfindung von iTunes ist die Musikindustrie nicht mehr das, was sie vorher war. Streaming hat den Download abgelöst und der Download hatte vorher schon den Kauf physischer Tonträger abgelöst. Oder denken Sie an Nokia. Die waren mal unbestrittener Marktführer in der Mobilfunkindustrie, heute ist von ihnen nicht mehr viel übrig, weil Apple mit seinem tastenlosen iPhone einfach mehr Ansichtsfläche und damit Nutzungsmöglichkeiten bot. Dass Smartphones über immer bessere Kameras verfügen, hat sich auch auf die Kameraindustrie ausgewirkt: Hier wurde ein Massen- zum Nischenprodukt, weil alle nur noch mit ihren Smartphones Bilder machen. Im Grunde hat jedes der großen Unternehmen, die wir heute kennen – Google, Netflix, Amazon – immer gleich mehrere Branchen disruptiert.
Das Interessante dabei ist, so schreiben Sie in Ihrem Buch, dass die Menschen, die als Disruptoren auftreten, oft Branchen verändern, in denen sie nie selbst vorher gearbeitet haben.
Das trifft, ich habe es für mein Buch recherchiert, auf 95 Prozent der Disruptoren zu! So hat ein Elon Musk nie vorher bei Airbus gearbeitet, hat nie Satelliten produziert oder bei einem Tunnelbauunternehmen angeheuert. Und jetzt erfindet er gerade mit dem Unternehmen The Boring Company den innerstädtischen Verkehr neu, indem er Autos unter der Erde vollautomatisch durch Tunnel fahren lässt. Disruptoren wollen mit Innovationen nicht in erster Linie bestehende Probleme lösen, sondern agieren frei und haben nichts zu verlieren. Deshalb können sie Sachen neu, anders und vor allem einfach machen.
Sorgt das für die größten Ängste bei klassischen und traditionellen Unternehmen: dass die Angreifer heute aus einer Ecke kommen, aus der keiner mit ihnen gerechnet hat?
Man hat die Angreifer nicht mehr auf dem Radar, wenn man nur noch in seiner Branche auf dem Laufenden ist. Die meisten Unternehmen kennen ihre Wettbewerber hervorragend: Jeder von BMW kennt jeden von Audi. Die meisten kennen zudem ihre Lieferanten und Kunden sehr gut. Was sie nicht gut kennen, ist immer öfter die eigene Wertschöpfungskette. Plus eins und minus eins – also Lieferant und Kunde – hat man auf dem Schirm. Doch minus zwei und plus zwei und so weiter tummeln sich jenseits des eigenen Horizonts.
Wie kriegt man sie aufs Radar, um rechtzeitig reagieren zu können?
Es gibt drei Richtungen, aus denen Disruptoren kommen können. Zuerst ist da der Disruptor aus dem eigenen Wertschöpfungspool, also meine eigenen Wettbewerber plus die Kunden und Lieferanten, plus eins und minus eins. Hier ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass mir deren Innovationen den Schlaf rauben, weil die genauso denken wie ich – und in derselben Wertschöpfungskette gefangen sind. Die zweite Gruppe ist alles in meiner Wertschöpfungskette außerhalb von minus und plus eins. Das heißt: Jeder, der in der Wertschöpfungskette tätig ist, den ich aber nicht kenne. Der Zulieferer eines Zulieferers, der ein wichtiges Teil herstellt, vielleicht einen Akku für meine Geräte, und plötzlich merkt, dass er das Gerät ja auch selber – und mit höherer Leistung – produzieren könnte. Das ist das Zweite und schon etwas größere Disruptionsrisiko. Gefahr droht aber in den meisten Fällen von einer dritten Gruppe: denjenigen, die nicht einmal in meiner Wertschöpfungskette sind. Plötzlich ist dieser Disruptor da und räumt meinen Markt um. Kann ich das mitbekommen? Die Antwort ist „Ja, aber“. Ich kann sie auf dem Schirm haben, aber nur, wenn ich die Gefahr ernst nehme.
Der Friedhof gescheiterter Unternehmen ist voll von Unternehmen, auf deren Grabstein steht ‚Ich bin im Recht gewesen‘. Oder ‚Ich meinte, mein Geschäftsmodell war gut.‘
Denn was ist die häufigste erste Reaktion auf einen Disruptor? Es ist Gelächter. Er wird nicht ernst genommen. Disruptoren machen sich nämlich eine einfache Strategie zu eigen: Sie greifen mit einem absolut lächerlichen Preis an oder mit einem Produkt, das es mit der Marktreife bestehender Produkte nicht aufnehmen kann.
Medial wird oft kolportiert, dass Disruptoren sich der modernsten aller Technologien bedienen – das stimmt aber gar nicht?
Nein. Disruptoren greifen oft mit Dingen an, die schon zwei, drei Jahre alt sind. Die aber in Kombination mit einem neuen Geschäftsmodell einen aggressiven Ansatz erhalten. Nehmen wir zum Beispiel E-Commerce oder Food Delivery. Das ist technologisch einfach, basierend eigentlich auf Lösungen der späten 1990er-Jahre. Der neue Ansatz ist nun das Fast Delivery, wie es in Deutschland Gorilla betreibt: Innerhalb von nur zehn Minuten hat man die Ware daheim. Das ist disruptiv. Und beim Preis ist es so, dass besonders anfänglich kostenlose Produkte belächelt werden. „Damit können die doch kein Geld verdienen!“ Oder: „Das ist nur eine Blase.“ Ganz ehrlich? Das hat man über Amazon am Anfang auch gesagt. Das hat man über Facebook gesagt, das hat man über Tesla gesagt. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, als Facebook von niemandem ernst genommen wurde, weil die Firma keinen Monetarisierungsversuch unternommen hatte. Doch was passiert? Es wird Reichweite aufgebaut, eine riesige Reichweite. Und dann wird das Monetarisierungsmodell oben draufgesetzt. Unternehmen wie Facebook und Google sind in Wahrheit Werbeunternehmen und vereinnahmen heute weltweit einen Marktanteil von 65 Prozent.
Die Faustregel ist also, neue – vielleicht auch kaum ersichtliche – Geschäftsmodelle von Beginn an ernster zu nehmen?
Ja, so kann man sich besser vorbereiten auf das, was passiert. Und der zweite Punkt ist, dass die Angreifer meistens sehr klein sind. Das macht sie flexibler. Da reicht das Ja einer einzelnen Person, und es wird gemacht. Von Rot auf Grün in wenigen Minuten. In einem Konzern brauchen Sie sehr lange, bis alle Ampeln auf Grün stehen. Und eine einzige rote Ampel kann hier auch noch alles blockieren.
Stichwort Veränderung. Warum denken Sie, gibt es einige Firmen, die damit hervorragend umgehen können, und andere, die bei der kleinsten Änderung in Panik ausbrechen?
Es gibt einen Markt- und es gibt einen psychologischen Grund. Zuerst zum Markt: Unternehmen tun Dinge, weil es der Konsument ihnen gesagt hat. Doch der Konsument versteht vom Markt genauso wenig wie Sie als Unternehmer. So hat Nokia die Kunden befragt: Wollt ihr Handys, die Tasten haben, oder Handys ohne Tasten? Und die haben natürlich alle geantwortet: Wir wollen Handys, die Tasten haben, weil wir SMS tippen wollen. Sie kannten es einfach nicht anders. Ein Steve Jobs hat vor der Erfindung des iPhones keinen einzigen Konsumenten befragt. Er handelte nach dem Prinzip „First Principle Thinking“. Auf Deutsch würde man sagen: Deduktion. Er hat sich die Frage gestellt: Was ist das Wichtigste und Emotionalste, das Menschen mit Smartphones tun können? Die Antwort: Fotos. Denn Menschen wollen in Echtzeit Erlebnisse teilen. Mit ihren Lieben, ihren Freunden, mit Kollegen. Doch Handys mit Tasten waren nicht gut für Fotos. Damit du Fotos in opulenter Qualität zeigen kannst, braucht es Fläche. Und das geht am besten, wenn es keine Tasten mehr gibt – dafür mehr Bildschirm. Es gab dafür bloß keinen Beweis, was bedeutet, dass das iPhone gegen die Marktforschung erfunden wurde. Aus gutem Grund:
Marktforschung ist immer ein Rückblick. Man fragt die selbst erzeugte, mit viel Werbeaufwand penetrierte Sicht auf die Wirklichkeit ab. Ich gebe als Unternehmen Millionen aus, um den Leuten mein Produkt nahezulegen, und frage sie dann: Was hättest du eigentlich gerne? Und die Leute antworten das, was ich ihnen durch die eigene Werbung beigebracht habe. Das erzeugt niemals innovative Produkte.
Und der psychologische Grund?
Wir alle werden gerne wertgeschätzt. Und Wertschätzung bedeutet, dass man denkt: Ich mache was Gutes. Sie gehen zur Arbeit, ich gehe zur Arbeit und wir beide bilden uns deshalb ein, dass wir wertvoll sind. Da gibt’s auch gute Gründe dafür. Der Disruptor hat aber einen anderen Blick auf die Dinge. Es gibt den bekannten Satz von Jeff Bezos: „Your Margin is my opportunity.“ Und was er damit meint: Beseitige ich alle Zwischenhändler in der Lieferkette und sorge ich dafür, dass das Produkt oder die Dienstleistung direkt an den Kunden geht, kann ich besseren Service zum kleineren Preis anbieten. Übertragen auf die Psychologie bedeutet es, dass ein Disruptor Sie und mich einfach aus der Gleichung streicht und sich mit meinem Kunden verbündet. Und das ist schockierend: Ihr und mein Wert werden damit auf null gesetzt. Wir sind „wertlos“ geworden in der neuen Wertschöpfungskette. Und wie reagiert die menschliche Psyche darauf? Sie geht dagegen an.
Konkreter?
Sie setzen der negativen Energie eine positive Energie entgegen. Das ist menschlich nachvollziehbar und eine gesunde psychologische Reaktion. Im Fall eines Unternehmens aber ist das eine gefährliche Aktion, da Sie so blind werden für die Gefahr des destruktiven Angriffs. Und wenn wir nun diesen psychologischen Aspekt mit dem Markt-technischen Grund kombinieren, ist klar, warum traditionelle Unternehmen die disruptiven Gefahren nicht rechtzeitig erkennen.
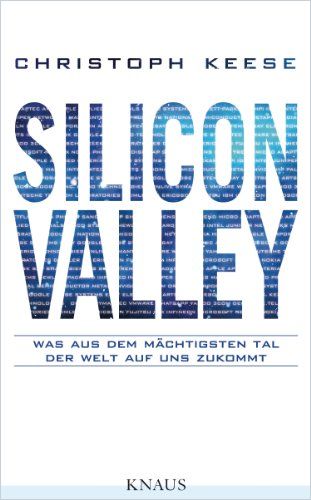
Sie arbeiten in der Medienbranche. Eine Branche, die durch die digitale Transformation auf den Kopf gestellt wurde. Wie haben Sie das für sich erlebt?
Ich kann mich da noch sehr genau an eine Podiumsdiskussion erinnern, das war Ende der 1990er-Jahre und die Blogosphäre hatte gerade damit begonnen, uns das Geschäftsmodell streitig zu machen: Ich lebte damals in einer Welt, in der Journalismus sehr wertvoll war. Wir waren die Erzeuger, die Vermittler von Wahrheit. Und wir wissen als Journalisten, wie schwer es manchmal ist, der Wahrheit nur schon nahezukommen. Wir wissen auch, dass wir sie selten hundertprozentig finden können. Aber unser Berufsethos sagt, dass wir diejenigen sind, die so lange Fakten zusammentragen und überprüfen, bis wir nah genug dran sind. Und wenn wir doch einen Fehler gemacht haben oder unsere Recherche unvollständig war, korrigieren wir das idealerweise. So steht es im Pressekodex. Und auf diesem Podium war ich zum ersten Mal direkt mit Bloggern konfrontiert, die diesem Kodex nicht unterliegen – weil sie sich selbst nicht als Journalisten sehen, sondern oft als Aktivisten. Und das ist einfach nicht dasselbe: Der echte Journalist schreibt in seinem Berufsethos und seinem Selbstverständnis fest, dass er sich niemals mit einer Sache gemein macht, und sei sie noch so gut. Man bleibt immer der kritische Hinterfrager. Ein Aktivist hingegen sieht das völlig anders. Der kämpft für die gute Sache, und zu diesem Zweck sind auch andere Mittel recht.
Wenn man die Reichweite anschaut, so haben die Blogger und Aktivisten die klassischen Journalisten längst abgehängt, oder? Und unter Letzteren gibt es auch immer mehr, die eher den Aktivisten als den Wahrheitssuchern nacheifern.
Das erfolgreichste Medium der Welt bei Twitter ist die New York Times. Sie hat 40 Millionen Follower. Aber ein Fußballer wie Ronaldo hat ungefähr 100 Millionen Follower. Er beschäftigt etwa fünfundzwanzig Redakteurinnen und Redakteure, die Social Media für ihn betreiben. Das ist größer als jede typische Sportredaktion. Nur werden diese 25 Leute von Ronaldo natürlich nie ein kritisches Wort über Ronaldo schreiben, weil sie von ihm bezahlt werden. Das ist kein unabhängiger Journalismus, das ist verlängerte PR. Dem Publikum wird es aber zunehmend egaler, sie erleben eine Art Pseudo-Wahrheit und die heißt „Nähe“. Ronaldo verbietet den Journalisten Zugang zur Kabine oder zu seinem privaten Haus, aber seinen eigenen Leuten gewährt er Zugang. Das heißt: Wenn das Publikum Nähe höher bewertet als Wahrheit, dann folgt es Ronaldos Social-Media-Aktivitäten. Das ist grundsätzlich okay, wenn sich das Publikum aktiv und aufgeklärt dafür entscheidet. Wenn jedoch zunehmend ausschließlich das für wahr gehalten wird, was hier suggeriert wird, dann wird es gefährlich. Wer PR mit Wahrheit verwechselt, wenn von alternativen Fakten geredet wird und wenn Wahrheit Dispositionsmasse persönlicher Meinungen und Haltungen wird, kommt sie in die Defensive.
Das heißt?
Das Publikum wird keinen Unterschied mehr machen und es wird eine neue Generation herangezogen, die das Streben nach unabhängigem Wissen und Wahrheit nicht mehr als ethischen Grundwert vermittelt bekommt. Es wird eine immer stärker verwaschene und verwischte Grauzone geben. Und was ich damals auf dieser Podiumsdiskussion dachte, ist genau so eingetreten: Effekte wie Verschwörungstheorien blühen, russische Hacker-Fabriken können Wahlen beeinflussen usw. Und das bedeutet nicht, dass ich ein Prophet bin, sondern dass wir ein Problem haben. Natürlich sind die Medien noch wichtig, doch es gibt eine alternative Medienwelt, die schon mächtiger ist als die traditionelle.
Aus Massenmedien sind Nischenmedien geworden. Oder anders: Es sind Elitemedien geworden.
Und das befördert eine Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite die Informationselite, die beruflich sehr erfolgreich ist, weil sie gut informiert ist, also auch der eigenen Haltung fremde, oft gar unangenehme Informationen zur Kenntnis nimmt. Und dann gibt es eine breite Masse, die keinen Zugang zu wahren Informationen mehr hat oder sich dafür entschieden hat, keinen Zugang mehr haben zu wollen. Und die haben eben auch wenig Erfolg im Beruf – was zu einer immer tieferen materiellen Spaltung führt.
Aktuell haben viele Menschen weniger Angst vor Desinformation als vor digitaler Transformation. Erstere bedroht zwar vielleicht die Demokratie – Letztere aber den eigenen Job. Was kann man ihnen sagen?
Schockstarre ist keine Alternative! An Automatisierung sind die Menschen eigentlich gewöhnt: Es gibt sie im Büro und in den Fabriken seit 150 Jahren, daher können die Menschen die Geschwindigkeit von Automatisierung relativ gut abschätzen. Wer also mit 25 Jahren einen Beruf ergreift, kann sich im Laufe seines Berufslebens ziemlich gut vor den Folgen dieser gewohnten Automatisierung schützen – oder sie annehmen. Was jedoch völlig neu in der menschlichen technologischen Entwicklungsgeschichte ist, ist, dass innerhalb einer Generation eine Technologie, die von einer Generation erfunden wurde, noch im Laufe des Berufslebens dieser Generation dazu führt, dass der eigene Job weg ist.
Der Dschinn wird aus der Wunderlampe gelassen – und meuchelt den Erfinder schon einige Sekunden später.
Das löst vor allen Dingen eine amorphe Angst aus, weil man nicht weiß, ob es einen selbst trifft und was man dagegen tun kann. Der zweite bemerkenswerte Effekt ist, dass früher galt: Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit. Doch in der Zukunft ist das anders. Selbst hoch qualifizierte Berufe, von denen man es gar nicht denken würde, sind nicht mehr sicher und werden von der disruptiven Innovation betroffen sein. Sicherer werden stattdessen Berufe, von denen man es bisher weniger annahm: Pflegerinnen, Psychotherapeuten und Physiotherapeutinnen zum Beispiel. Es kann wirklich gut sein, dass ein hoch spezialisierter Chirurg früher wegdigitalisiert wird als die Krankenschwester, denn es gibt bisher nicht einmal den Ansatz einer Entwicklung, die dazu führen könnte, dass Maschinen unsere soziale wie emotionale Intelligenz ein-, geschweige denn überholen werden.
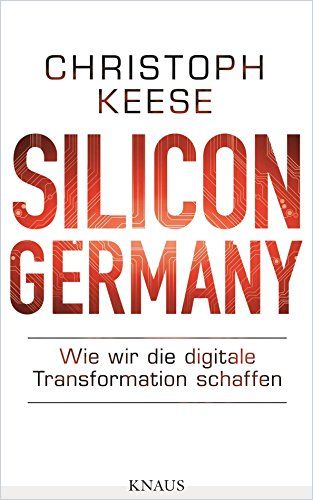
Kurz noch zu den Wissensträgern in Unternehmen: Wie schafft es eine Organisation, das für Innovation nötige Wissen im Haus zu behalten?
Neudeutsch spricht man hier von Retention. Und es geht um die große Frage: Wie halte ich Leute? Auch der Arbeitsmarkt ist schließlich nicht mehr der, der er vor 15 oder sogar nur 10 Jahren mal war. Die lebenslange Beschäftigung ist nicht mehr das Ideal vieler Menschen, Sinn und Zweck stehen nun im Fokus von Entscheidungen. Es geht daher verstärkt darum, gute Leute zu binden. Ihnen einen Raum zu schaffen, der Lust macht, engagiert weiter mitzuarbeiten und etwas zu unternehmen. Das Ganze aber hat auch eine Kehrseite, weil Wissen heute oft eine Illusion ist:
Derzeit verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle fünf Jahre. Das bedeutet, dass jemand, der vor 30 Jahren seinen Uni-Abschluss gemacht hat, nur noch ein Vierundsechzigstel des relevanten Wissens auf dem Gebiet hat, wo er mal alles wusste – oder zu wissen glaubte.
Und damit sind wir beim lebenslangen Lernen: Unternehmen müssen schauen, wie sie ihre Leute davon abhalten, ihr Wissen zu verabsolutieren. Sie müssen offen sein für ständige Weiterentwicklung. Die zentrale Frage ist: Wie ermächtige ich sie dazu, neue Lernformen zu akzeptieren und zu nutzen? Derzeit kämpfen so viele Personalchefs, Unternehmerinnen und Unternehmer in traditionellen Unternehmen damit, dass die Leute sich für qualifiziert halten und nicht offen sind für eine Weiterentwicklung, die sie trotzdem dringend brauchen. Das ist die große Herausforderung im Management des Wandels.
Schon lustig, denn wenn es um unsere Technik geht, haben wir keine Angst vor Updates: Da drücke ich einen Knopf und es läuft.
Sie haben gerade etwas sehr Wichtiges gesagt: Ich drücke auf den Knopf. Der Satz hat ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt. Ich ist das Subjekt. Das Verb ist drücken und Knopf ist das Objekt. Schwierig wird es jetzt aber, wenn in diesem Satz das Subjekt und das Objekt gleichzeitig ich bin. Also: Ich update nicht das Handy, sondern ich update mich. Das hat ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, während die eigene Wahrnehmung uns doch immer in den Mittelpunkt des Universums stellt. Ich glaube: Wir müssen verstärkt an unserer Selbstwahrnehmung arbeiten. Wir alle wissen, dass wir nach drei Jahren ohne ein Update das Handy vergessen können. Warum also fällt es uns so schwer, das auch für uns zu akzeptieren?
Über den Autor
Christoph Keese ist Journalist und Publizist. Er war unter anderem Chefredakteur der Welt am Sonntag und der Financial Times Deutschland sowie Executive Vice President der Axel Springer SE. Aktuell ist er Geschäftsführer bei der Axel Springer hy GmbH.







