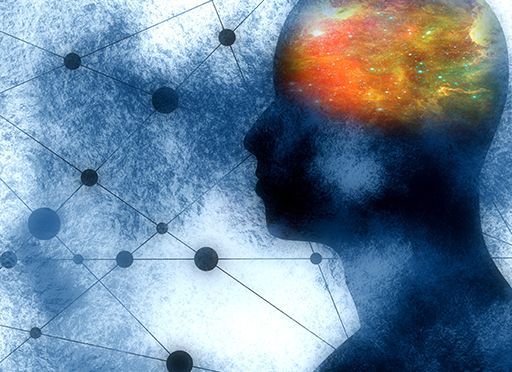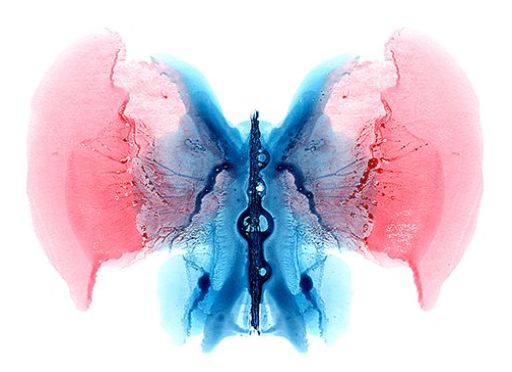„Erst das Nachdenken über den Stress führt zum Zusammenbruch.“

Frau Callesen, in Ihrem Buch stellen Sie die Ansätze der metakognitiven Therapie vor. Können Sie kurz erklären, worum es dabei geht?
Pia Callesen: Nun, es ist eigentlich ein neues Paradigma in der Psychologie. In anderen Therapieformen, vor allem der verbreiteten kognitiven Verhaltenstherapie (CBT), verbringt man viel Zeit damit, an den Gedanken und Gefühlen der Menschen zu arbeiten. Man setzt sie Dingen aus, vor denen sie Angst haben, und versucht, ihre Wahrnehmung von gewissen Dingen so zu verändern, dass ihre Gedanken positiver werden. Bei der metakognitiven Therapie geht es jedoch nicht um den Inhalt der Gedanken und auch nicht um Exposition. Sie geht eher davon aus, dass man zu viel Zeit mit seinen Gedanken verbringt. Wenn man zur Therapie geht, erwartet man normalerweise, dass man mit dem Therapeuten seine Gedanken und Gefühle bespricht.

Da das bei der metakognitiven Therapie nicht der Fall ist, ist es ein völlig anderer Ansatz zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen. In diesem Paradigma werden Depressionen und Ängste durch zu viel Nachdenken, Grübeln, Sorgen usw. verursacht und aufrechterhalten, indem man zu viel Zeit mit diesen Emotionen verbringt. Das hält die negative Stimmung erst aufrecht.
Viele Bücher im Bereich Selbsthilfe und Psychologie behaupten genau das Gegenteil. Marc Brackett etwa sagt in seinem Buch „Die Kraft der Gefühle“, dass negative Emotionen nicht einfach verschwinden, wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt.
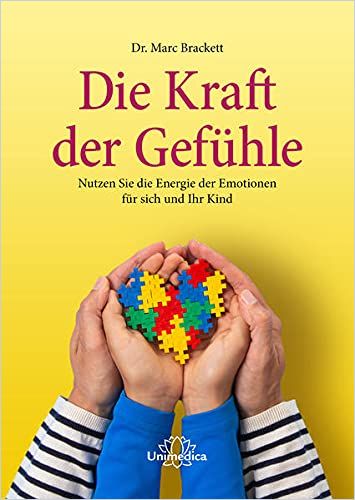
Ich weiß nicht, worauf er seine Aussagen stützt, denn die metakognitive Therapie basiert auf einer Menge Forschung. Adrian Wells hat viel darüber geforscht, wie Emotionen funktionieren. Er hat einige interessante Studien im Labor durchgeführt, bei denen er nicht depressive Studenten an der Universität gebeten hat, eine Übung durchzuführen. Die eine Gruppe durfte danach nicht grübeln, während die andere Gruppe über ihre Gedanken nach der Übung grübeln musste. Dann wurde die depressive Stimmung bewertet. Die Grüblergruppe war depressiver als die andere. Als die jungen Leute mit dem Grübeln aufhörten, wurden sie wieder glücklich. Daraus schließen wir, dass sich Emotionen selbst regulieren, wenn man sie nur lässt. Wenn man sie nicht in Ruhe lässt, dann natürlich hören sie auch nicht auf, wehzutun.
Allerdings erscheint es doch irgendwie intuitiv richtiger, dass dieses Grübeln ein Teil eines Heilungsprozesses ist und dass man sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen muss, um voranzukommen.
Ich glaube nicht, dass es Teil der Heilung ist. Im Gegenteil: Wenn es dir besser gehen soll, darfst du dich nicht lange mit diesen Gefühlen aufhalten.
Es ist wie mit einer Wunde. Wenn du willst, dass die Wunde heilt, darfst du nicht zu sehr daran kratzen. Das verlängert den Heilungsprozess nur.
Pia Callesen
Man sollte sie also besser in Ruhe lassen. Und so ist es auch mit den Gedanken und Gefühlen.
Natürlich ist das etwas überraschend. Sowohl Sie als auch Marc Brackett sind Experten auf dem Gebiet – und da müsste doch an beiden Theorien etwas dran sein. Sie glauben also nicht, dass es womöglich eine falsche und eine richtige Art zu „kratzen“ gibt?
Die Studien zur metakognitiven Therapie zeigen, dass, wenn man zu viel Zeit mit seinen Gedanken verbringt, unabhängig davon, womit genau man die Zeit verbringt, das Problem, mit dem man sich gedanklich befasst, langfristig aufrechterhalten wird. Wohl jeder grübelt hin und wieder. Aber es gibt Menschen, die den ganzen Tag damit verbringen, nach Antworten suchen, über ihre Probleme sprechen … Da macht vor allem die Dosis das Gift. Ich würde sagen, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, um gedanklich bei seinen Problemen zu verweilen. Es ist eher so, dass man zu viel Zeit mit Verweilen verbringen kann – etwa, wenn man es zehn Stunden am Tag tut.
Dann ist es also vor allem ein Zeitproblem?
Wenn man ein Problem hat, kann es durchaus Sinn machen, sich Gedanken darüber zu machen, um eine Lösung zu finden. Aber damit das nicht ausartet, hat sich das Konzept der Grübelzeit bewährt.
Können Sie das erklären?
Das ist eine gewisse Zeitspanne, in der man sich erlaubt, sich mit seinen Problemen zu beschäftigen, wenn man das Bedürfnis danach verspürt. Man sagt sich also etwa: „Immer um 17 Uhr abends darf ich 30 Minuten grübeln.“ Oft machen die Leute dann die Erfahrung, dass sie zu diesem Zeitpunkt gar keine Lust zum Grübeln haben. Vielfach haben sich die Probleme von selbst erledigt. Sie wollen nicht mehr darüber nachdenken und so verschwinden sie von selbst. Und man macht die Erfahrung, dass man das Grübeln gar nicht braucht.
Take-aways:
- Die Metakognitive Therapie geht davon aus, dass es schädlich ist, wenn man zu viel Zeit mit seinen Gedanken und Emotionen verbringt – es führt zum kognitiven Aufmerksamkeitssyndrom.
- Das kognitive Aufmerksamkeitssyndrom umfasst mehrere schädliche Umgänge mit schwierigen Gedanken: Grübeln, Sorgen, permanenter Stimmungs-Check und ungeeignete Bewältigungsstrategien wie etwa Vermeiden oder Unterdrücken.
- Statt sich ständig mit seinen Emotionen zu befassen, sollte man sie einfach in Ruhe lassen, sie anerkennen, aber nichts dagegen tun.
Das ist ein gutes Experiment, um auszuprobieren, ob man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Grübeln warten kann. Und man macht womöglich die Erfahrung, dass sich die Emotionen selbst regulieren.
Was man auch immer wieder – und auch in Ihrem Buch – liest, ist, dass man das Unterdrücken negativer Emotionen vermeiden sollte. Und ich glaube viele Menschen halten Grübeln für notwendig, weil sie, wenn sie es nicht tun, sich so fühlen, als würden sie die negativen Gefühle unterdrücken.
Unterdrücken sollten Sie Ihre Emotionen nie. Sie merken, dass Sie sie aktiv unterdrücken, wenn es sich anstrengend anfühlt. Man kann sie aber auch einfach in Ruhe lassen, sie anerkennen, aber nichts dagegen tun. Und das sind zwei verschiedene Handlungen.
Und wie würde so ein passives Anerkennen aussehen?
In dem Buch erwähne ich die losgelöste Achtsamkeit. Das ist nicht einfach ein leerer Geist. Man hat immer noch Gedanken und Gefühle. Aber statt Energie dafür zu verwenden, an dem Problem gedanklich zu arbeiten, betrachtet man es nur. Man könnte sagen, es ist eine Art von Faulheit. Du spürst die Emotionen, aber du regst dich gedanklich nicht, um etwas dagegen zu tun. Du bist immer noch traurig, du siehst immer noch, dass du bestimmte Gedanken über was auch immer hast, aber du verhältst dich träge, faul ihnen gegenüber. Du beobachtest nur, dass sie da sind.
Allerdings erwähnen Sie in Ihrem Buch auch die sogenannten Triggergedanken, die eine negative Gedankenspirale auslösen. Und die haben einen Sog. Braucht es dann nicht doch Energie, diesem Sog aktiv zu widerstehen?
Natürlich, man muss sich selbst anweisen, dem Sog zu widerstehen.
In dem Buch vergleiche ich die Gedanken mit Zügen. Man kann aufspringen und mitfahren – oder man bleibt einfach am Bahnhof stehen und beobachtet, wie die Züge ein und ausfahren.
Pia Callesen
Und natürlich muss man sich erst anhalten, nicht auf den entsprechenden Zug aufzuspringen. Aber wenn man das einmal weiß, muss man diese Anweisung ja nicht immer wieder wiederholen.
Und was ist, wenn man dann plötzlich doch feststellt, dass man auf einem Zug gelandet ist, den man meiden wollte?
Das kann am Anfang durchaus passieren. Es gibt Leute – meist depressive Patienten –, die nicht merken, dass sie grübeln. Da vergehen vielleicht zwei Stunden und plötzlich realisieren sie, wo sie eben gedanklich waren. Solchen Leuten fällt es natürlich schwer, dem Sog zu widerstehen, weil sie nicht bemerken, wenn sie da hineingezogen werden. Hier hilft das Aufmerksamkeitstraining. Dabei lenkt man seine Aufmerksamkeit aktiv an unterschiedliche Orte, um ein Bewusstsein für die eigene Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist natürlich sehr energieaufwändig. Aber es zeigt den Leuten, dass sie in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit zu steuern.
Und so lernt man, wieder von den Zügen abzuspringen?
Genau. Abspringen kann bedeuten, dass du deine Aufmerksamkeit wegbewegst (anders fokussierte Aufmerksamkeit). Aber es kann auch bedeuten, einfach nur den Strom des Bewusstseins zu betrachten (passive Aufmerksamkeit). Sie müssen also einerseits in der Lage sein, Ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern. Aber andererseits auch, einfach nur präsent zu sein, ohne sich mit seinen Gefühlen und Gedanken zu beschäftigen. Beides trainieren wir in der Therapie.
Gibt es bestimmte Regeln, wann man diese fokussierte und wann die passive Aufmerksamkeit einsetzen sollte?
In der Nacht würde ich die passive Aufmerksamkeit wählen, weil man nachts seine Energie nicht darauf verwenden will, seine Aufmerksamkeit zu bewegen. Und tagsüber, etwa, wenn man mit seinen Kindern zusammen ist oder wenn man arbeitet, ist es wahrscheinlich eine gute Sache, aufmerksam zu sein und die Aufmerksamkeit auch bewusst zu bewegen.
In vielen psychologischen Ratgebern liest man, dass regelmäßige Selbstreflexion absolut essenziell ist, um mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Sie allerdings sagen, dass das durchaus schädlich sein kann.
Sich zwanghaft mit sich selbst immer wieder auseinanderzusetzen ist ein Teil des kognitiven Aufmerksamkeitssyndroms, auf Englisch cognitive-attentional syndrome, kurz CAS.
Können Sie das kurz erklären?
CAS ist der Begriff für einen überfokussierten Denkprozess. Man konzentriert seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Gedanken und Gefühle und verbringt dann zu viel Zeit damit. Dieser Ablauf ist in der metakognitiven Therapie die Ursache aller psychologischen Probleme.
Ist Selbstreflexion also schädlich?
Wenn sie zu lange betrieben wird, ja. Oft ist man dann eher verwirrt, als dass man wirklich neue Erkenntnisse gewinnt. Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, sich zu fragen, wer man ist und was man von sich selbst will, wird man oft nur noch verwirrter.
Allerdings gibt es schon Menschen, die weniger zum Grübeln neigen und eher dazu, Dinge ganz von sich wegzustoßen und sich abzulenken. Die leiden dann aber oft etwa an Panik- oder Angstattacken, weil sie die Gedanken doch belasten.
Das liegt dann aber eher daran, dass sie die Gedanken mit dem permanenten Unterdrücken genauso wenig in Ruhe lassen, wie wenn sie ständig grübeln würden. Das kognitive Aufmerksamkeitssyndrom umfasst mehrere schädliche Umgänge mit schwierigen Gedanken:
- Grübeln,
- Sorgen,
- permanenter Stimmungs-Check,
- ungeeignete Bewältigungsstrategien wie Vermeiden, Unterdrücken, Zwanghaft-ins-Positive-Kehren oder Sich-Betäuben.
Was Sie beschreiben, klingt eher nach Letzterem. Wenn Sie Emotionen einfach in Ruhe lassen, stauen sie sich nicht einfach so auf. Es gibt dann keine Katharsis oder so etwas in der Art. Dazu müssen Sie schon Druck ausüben, etwa indem Sie sie eben unterdrücken bzw. verdrängen. Dieses Unterdrücken ist quasi der Treibstoff, der es überhaupt am Laufen hält. Wenn jemand also Panikattacken hat, würde ich als Erstes danach suchen, welche der CAS-Strategien diese Person betreibt. Wenn sie nicht grübelt, wäre meine erste Intention, nach einem Kontrollverhalten Ausschau zu halten. Überwacht sich diese Person ständig und fragt sich: „Wie geht es mir jetzt? Kommt es jetzt, kommt es jetzt, kommt es jetzt?“? Damit erhält sie es erst aufrecht.
Was tut man, wenn man realisiert, dass man tatsächlich eine dieser CAS-Strategien verinnerlicht hat?
Grundsätzlich kann man sagen, dass man sich einfach nicht zu lange mit seinen Gedanken aufhalten sollte. Ich würde sagen, alles, was ungefähr nach 10, 15 Minuten noch nicht abgeschlossen ist, ist zu lange. Denken Sie kurz nach und treffen Sie schnell Entscheidungen. Notfalls können Sie dann immer noch Ihre geplante Grübelzeit nutzen.
Ich würde gerne noch einen Teil aus Ihrem Buch besprechen, den ich etwas schwierig fand. Sie raten darin, ganz bewusst und extra Dinge zu tun, für die man keine Motivation empfindet.
Gerade Menschen mit Depressionen kann es helfen, zu sehen, dass man durchaus Dinge tun kann, ohne dass man große Motivation dazu empfindet, ja.
Könnte eine solche Übung aber nicht dazu führen, dass man, wenn man das oft macht, den Kontakt zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen verliert?
Nur weil Sie sich nicht immer wieder fragen, wie es Ihnen bei dem geht, was Sie gerade tun oder was Sie wollen, verlieren Sie nicht den Kontakt zu sich selbst. Ihr Körper wird Ihnen immer deutlich signalisieren, wenn etwas zu viel für Sie wird: Sie bekommen Kopfschmerzen, eine Panikattacke, werden übermäßig müde usw. Dann allerdings fangen die meisten mit einer CAS-Strategie an. Und das ist das eigentliche Problem.
Take-aways:
- In der metakognitiven Therapie geht man davon aus, dass eine zu intensive Beschäftigung mit den eigenen Gedanken und Gefühlen die Ursache von Depressionen oder Angstzuständen ist.
- Das kognitiven Aufmerksamkeitssyndrom (CAS) bedeutet, sich zu sehr mit seinen Problemen zu beschäftigen: durch Grübeln, Sorgen, andauernden Stimmungs-Check oder Verdrängen.
- Es gilt, die Kontrolle über seine Aufmerksamkeit zu gewinnen und sie entweder anderweitig zu fokussieren oder negative Gedanken und Gefühle passiv zu beobachten.
Wenn Sie einfach auf Signale Ihres Körpers hören und Ihr Verhalten entsprechend anpassen würden, wäre das kein Problem. Auch wenn Sie weitermachen und die Signale ignorieren, wäre das zwar unangenehm, aber dennoch nicht lebensgefährlich. Doch was viele stattdessen tun, ist, in diese ungesunden Verhaltensspiralen zu kommen: „Oh Gott, ich habe nicht genug auf mich gehört. Warum habe ich das getan? Ich hätte es tun sollen. Wird der Stress mich jetzt zugrunde richten? Werde ich es je wieder hier rausschaffen?“ Es beginnt also das „Overthinking“ – und das ist schließlich der längerfristige Stress, unter dem Menschen zusammenbrechen.
Es gibt aber durchaus Leute, die den Kontakt zu sich selbst verlieren – in Extremfällen in Form einer Dissoziation. Liegt das dann auch nur am CAS?
Das CAS ist das eigentliche Problem. Wenn Leute merken, dass ihre kognitiven Funktionen nachlassen oder dass sie vielleicht plötzlich nicht mehr wissen, wo sie wohnen oder wie sie heißen, könnten sie das als normales Signal dafür sehen, dass sie sich gerade zu viel aufgehalst haben und vermutlich etwas ändern sollten. Und dann aufhören, darüber nachzudenken. Wenn man jedoch anfängt, sich darum zu sorgen, sich denkt: „Oh Gott, ich kann mich an nichts mehr erinnern! Was ist, wenn mein Verstand nie wieder richtig funktioniert?“ usw., hat man auf Dauer nur noch Stress, der schließlich zum Zusammenbruch führt.
Es ist also tatsächlich eine Art Überfokussierung auf die eigenen Probleme und die damit verbundenen CAS-Strategien, die dazu führt, dass man sich von sich selbst entfernt?
Das klingt paradox: Je mehr du dich auf dich selbst fokussierst, desto mehr verlierst du dich. Aber ja, so ist es.
Dennoch: Sie sagen, dass wir im Alltag viele Dinge ohne Motivation tun, etwa die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder Zähne zu putzen. Aber liegt diesen oberflächlich mühsamen Dingen nicht doch eine Motivation zugrunde? Ich will sauberes Geschirr, ich will gesunde Zähne?
Es gibt eine Menge Dinge, bei denen wir uns gar nicht fragen, wie motiviert wir dazu sind, weil es keine Rolle spielt. Oder fragen Sie sich jeden Tag, wie motiviert Sie heute sind, zur Arbeit zu gehen? Es wird viele Tage geben, an denen Sie dazu nicht sehr motiviert sind, und das ist normal. Auch wenn Sie das schlussendlich tun, um Geld zu verdienen, kann Ihre akute Motivation doch sehr gering sein.
Sobald Sie sich fragen, wie sehr Sie etwas gerade tun wollen, beginnen Sie einen inneren Dialog mit sich selbst. Und der ist meistens nicht sehr hilfreich – gerade bei Dingen, die Sie einfach tun müssen.
Pia Callesen
Generell scheint vielen Leuten nicht bewusst zu sein, dass Hochs und Tiefs einfach zum Menschsein dazugehören – und dass sie jeder hat. Vielen Menschen mit Depressionen ist etwa nicht bewusst, dass eigentlich jeder Mensch oft keine Lust hat, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Menschen mit Zwangsstörung sind überrascht, dass es sehr viele Leute gibt, die Intrusionen (also durch Trigger ausgelöste unkontrollierbare schmerzhafte Erinnerungen, Fragen oder Gedanken, die vielfach mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern oder Panikattacken einhergehen) erleben, ohne dass sie eine Zwangsstörung oder Ähnliches haben.
Sie schreiben, dass man Dinge wie Depressionen oder Angststörungen mit den richtigen mentalen Strategien kontrollieren kann.
Wir können Depressionen, Angstzustände und andere anhaltende psychische Störungen anhand der losgelösten Achtsamkeit kontrollieren, das ist richtig.
Könnte es da nicht sein, dass sich Leute vielleicht als Versager fühlen, wenn sie es nicht schaffen? Weil es ja eigentlich in ihrer Verantwortung läge, das zu ändern?
In der metakognitiven Therapie arbeiten wir genau daran: dass man erkennt, dass man selbst die Kontrolle hat. Man hat eine gewisse Macht und muss nicht einfach Opfer seiner emotionalen Störungen sein. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch eine gewisse Verantwortung, diese Kontrolle zu nutzen, das ist richtig. Die meisten Menschen müssen aber erst lernen, dass sie diese Kontrolle überhaupt haben – deshalb kommen sie zur Therapie. Wir erwarten also nicht, dass die Leute das von Anfang an tun oder dass sie diese Dinge dann plötzlich einfach so kontrollieren können. Es bedarf einer angemessenen metakognitiven Therapie – und die hilft immerhin 80 von 100 Leuten dabei, diese Kontrolle zu erlangen.
Und was ist mit den anderen 20 Leuten?
Die grübeln vielleicht eher darüber nach, dass sie zwar die Kontrolle haben, es aber trotzdem nicht schaffen. Und damit gehen sie die Sache sowieso falsch an, denn:
Man kann ein Grübelproblem nicht mit mehr Grübelei lösen.
Pia Callesen
Aber die 80 Leute, denen wir diese Kontrolle zeigen können, sind davon überzeugt, dass sie es schaffen können, und die werden auch nicht rückfällig. Ich denke also, dass es diesen Versuch wert ist. Die Erfolgsquote ist immerhin höher als bei anderen Therapien.
Würden Sie also sagen, die metakognitive Therapie ist wirklich für jeden und die 20 Prozent machen es falsch? Oder gibt es vielleicht Leute, für die andere Therapieformen besser geeignet sind?
Ich denke, dass einige Leute mit der falschen Einstellung in die Therapie kommen: Sie wollen ihre Gefühle loswerden. Sie möchten keine Gedanken haben, keine Trigger. Und dann sind sie ein bisschen enttäuscht, weil man das in der metakognitiven Therapie nicht machen kann. Wir können ihre Probleme im Leben nicht beheben, wir können ihnen keine nettere Frau oder keinen netteren Mann geben, wir können Sie nicht mehr oder weniger traurig machen. Wir können also weder die Gefühle noch die Gedanken der Menschen wirklich ändern. Wir haben vielmehr das Ziel, dass sie lernen, ihre Gedanken und Gefühle einfach in Ruhe zu lassen. Aber natürlich, die metakognitive Therapie ist nicht der letzte oder einzige Weg. Es gibt unzählige weitere Therapieformen – geholfen werden kann Ihnen also immer.
Über die Autorin
Pia Callesen ist Psychologin und Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt metakognitive Therapie.