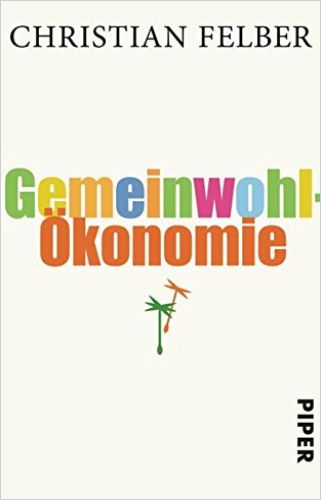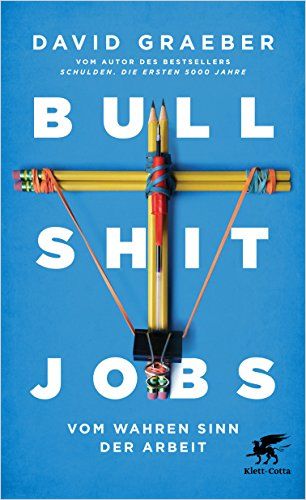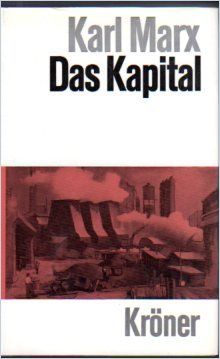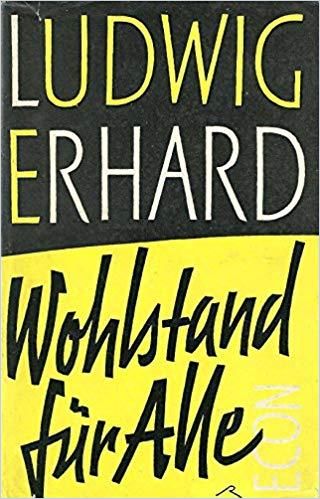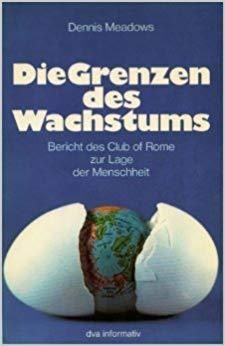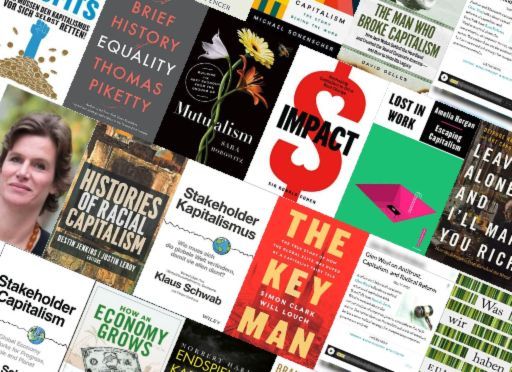„Eine Welt, die wächst und das Klima schont, ist möglich.“

getAbstract: Herr Binswanger, beim Thema „Wachstum“ scheiden sich die Geister. In der Debatte darum, so scheint es, gibt es nur zwei Lager: Wachstumsbegeisterte und Wachstumsgegner.
Mathias Binswanger: Der Eindruck stimmt. Menschen sind gerne für etwas oder gegen etwas. Deshalb fällt es oft schwer, Phänomene wie das Wachstum in ihrer Ambivalenz zu erkennen. Das war auch mit ein Grund dafür, warum ich Der Wachstumszwang geschrieben habe.
Dann beginnen wir mit der Essenz des Buches: Was würden Sie einem unbedingten Wachstumsbefürworter gern ins Stammbuch diktieren – und was seinem Gegenüber?
Ersterem würde ich sagen: Wachstum ist kein Selbstzweck! Wachstum ist nur Mittel zum Zweck. Und wenn mehr Wachstum nicht länger dazu beiträgt, dass die Menschen glücklicher und zufriedener werden, sie also kein mit dem Wachstum steigendes, subjektives Wohlbefinden mehr ausweisen können, dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes „unökonomisch“, weiter zu wachsen.
Zu diesen Punkten kommen wir gleich. Zuerst noch die Lektion für den unbedingten Wachstumskritiker, bitte.
Ihm würde ich sagen: Wachstum hat unseren ungeheuren Wohlstand geschaffen, der dir überhaupt erst die Zeit, Muße und das Geld gibt, über Sinn und Unsinn von Wachstum nachzudenken. Wer das Wachstum „abschaffen“ will, braucht außerdem eine Idee, wie eine funktionierende Wirtschaft ohne Wachstum auskommen soll – und Stand heute, wenn ich das Wissen über uns bekannte Wirtschaftssysteme richtig überschaue, gibt es diese Idee nicht.
Von der Gemeinwohlökonomie bis zum Bedingungslosen Grundeinkommen: das sind alles vage Konzepte, die empirisch immer auf Quersubventionen aus kapitalistischen Wachstumsgesellschaften angewiesen sind und diese insgesamt nicht ersetzen.
Mathias Binswanger
Damit haben wir Schwachstellen der Argumentationen beider Lager schon benannt. Bleibt zur angeregten Diskussion nur noch eine Definition des Gegenstands: Was genau ist eigentlich Wachstum – und wie entsteht es?
Wenn wir von Wachstum reden, reden wir von Wirtschaftswachstum. Und dieses Wirtschaftswachstum messen wir Ökonomen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene – also anhand des Bruttoinlandproduktes. Das ist etwas, was der einzelne Bürger nicht direkt „spürt“. Und vielleicht ist die Diskussion um das Wachstum auch deshalb so polarisiert und mitunter emotional.
Wie meinen Sie das? Menschen, die am Wirtschaftsleben teilnehmen, also Arbeit haben und Geld verdienen, das sie dann wieder ausgeben können, wissen doch sehr genau, dass Wachstum über Erfolg und Niedergang von Firmen und Volkswirtschaften entscheiden kann.
Jeder von uns erlebt seine eigene wirtschaftliche Tätigkeit und trägt damit auch sein Scherflein zum BIP bei. Wir können aber kaum abschätzen, was das im Hinblick auf die gesamtgesellschaftlichen Abhängigkeiten vom Wachstum bedeutet. Klar ist: Wenn alle versuchen, zu wachsen, und die meisten damit auch erfolgreich sind, dann schlägt sich das in einem wachsenden Bruttoinlandprodukt nieder. Es umfasst alle Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres produziert und dann für Geld als Endprodukte verkauft werden. Ist das Volumen höher als im Jahr zuvor, sprechen wir von Wirtschaftswachstum. Dieses führt dann gleichzeitig auch zu steigenden Einkommen und dadurch zu mehr materiellem Wohlstand.
Was vergleichsweise simpel klingt, ist alles andere als das. In Ihrem Buch erklären Sie anschaulich, dass dieser Prozess in der Menschheitsgeschichte die Ausnahme und nicht die Regel ist. Seit wann also gibt es Wirtschaftswachstum?
An den oben beschriebenen Zyklus haben wir uns in den letzten 200 Jahren gewöhnt. Viele Menschen erachten Wirtschaftswachstum deshalb als etwas „Normales“, fast Natürliches. Doch das ist es ganz und gar nicht – wie mit Blick auf die Vergangenheit klar wird: Bis um das Jahr 1800 herum war es eigentlich umgekehrt.
In tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte hat es nur sehr langsames oder gar kein Wirtschaftswachstum pro Kopf gegeben. Stagnation war der Normalfall.
Mathias Binswanger
Der Grund dafür ist, dass Boden der wichtigste und dominante Produktionsfaktor in der Landwirtschaft ist, die früher den größten Teil der Wirtschaft ausmachte.
Alles hing von mehr oder weniger fruchtbarer Fläche ab – das war die „natürliche Grenze“ des Wachstums?
Ja. Erst mit Beginn der industriellen Revolution änderte sich das, denn jetzt wurde Kapital zum wichtigeren Produktionsfaktor: Maschinen, Anlagen, später Computer, Roboter, Algorithmen … in diese Werkzeuge kann investiert und damit die produktive Kapazität immer weiter erhöht werden. Das Ergebnis ist unser nun beispielloser Wohlstand. Und wenn das Wachstum heute doch einmal ausbleibt, empfinden wir es schon als einen pathologischen Zustand, den man möglichst schnell wieder beseitigen muss. Da darf dann notfalls auch der Staat mit keynesianischer Wirtschaftspolitik mithelfen.
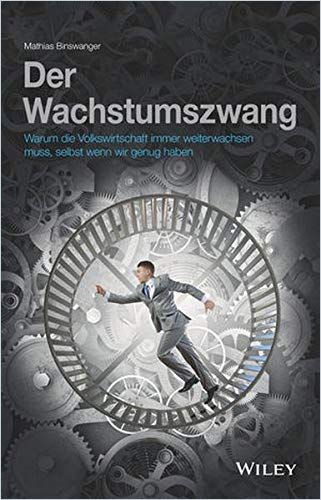
Damit sind wir beim Wachstumszwang. Beginnen wir mal mit der ersten, der individuellen Ebene. Im angelsächsischen Raum ist immer wieder von einem sogenannten „Growth-Mindset“ die Rede, das sich etablieren müsse, damit Menschen sich engagieren und selbst wachsen wollen. Wenn ich Ihnen nun so zuhöre, muss ich sagen: Offenbar haben die allermeisten Zeitgenossen schon so eines, weil sie Wachstum und Produktivitätssteigerungen als etwas Natürliches ansehen. Nicht?
(Lacht.) Na, ohne dieses Mindset funktionierte ja das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht! Über die letzten Jahrhunderte musste man denn auch kaum darauf hinweisen: Die Leute sahen ihren persönlichen Vorteil in steigendem materiellem Wohlstand, weil damit steigende Zufriedenheit verbunden war. Wo zu Beginn der industriellen Entwicklung noch Elend war, entstand materieller Wohlstand, ja Reichtum, und zwar fast flächendeckend. Das ist die große Errungenschaft der Wachstumsgesellschaften und ihres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, des Kapitalismus. Das Problem ist nun allerdings, dass viele Mitmenschen in den letzten Jahren nicht mehr zufriedener wurden, obwohl der Wohlstand weiterhin steigt.
Was ist passiert?
Es trat eine gewisse Sättigung ein: Die Leute werden nicht mehr im selben Maße glücklicher wie sie reicher werden. Es gibt jede Menge Studien, die das bestätigen, und zwar aus verschiedenen Teilen der industrialisierten Welt.
Wenn wir nun also annehmen, dass sich Wohlstandszuwachs und Glück ab einem gewissen Punkt voneinander abkoppeln, weil die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen gedeckt sind, müsste man fragen: Ist dann mehr Wachstum ökonomisch noch sinnvoll? Die Ökonomie hat darauf eine klare Antwort: Nein.
Mathias Binswanger
Etwas ist ökonomisch sinnvoll, wenn es den Nutzen und damit das subjektive Wohlbefinden der Haushalte erhöht. Führt Wachstum nicht mehr dazu, dann entfällt seine ökonomische Rechtfertigung.
Sie sagen, das Ziel „Wohlstand für alle“ sei heute erreicht, wo man Wachstum zugelassen habe?
Zumindest ist in den industrialisierten Ländern materielle Armut, wie man sie über tausende von Jahren als treue, unliebsame Begleiterin der Menschheit kannte, großenteils beseitigt. Der erarbeitete Wohlstand ist zwar nicht überall gleich verteilt, aber im Durchschnitt so hoch, dass mehr davon sich nicht mehr signifikant auf die Zufriedenheit der Menschen auswirkt, was doch eine in der Menschheitsgeschichte ebenfalls einzigartige Situation ist. Gleichzeitig erkennen wir aber, dass unser bisheriges Wachstum auch erhebliche Kollateralschäden mit sich brachte und bringt, etwa was den Umgang mit natürlichen Ressourcen angeht, also wie wir Umwelt und Klima schädigen. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit – und sie hängt sehr eng mit dem Wachstum und vor allem dem Wachstumszwang zusammen. Es klingt deshalb plausibel, wenn manche Leute nun vorschlagen, dass es doch jetzt vielleicht „reiche“ mit dem Wachstum.
Zu den Grenzen des Wachstums kommen wir später noch. Zuerst: Glauben Sie nicht, dass die Menschen vor 20, 50 oder 70 Jahren, wenn man Sie nach ihrer Wohlstandssättigung gefragt hätte, auch mit „Es reicht uns eigentlich jetzt“ geantwortet hätten? Niemand konnte ja ahnen, in welche Höhen des materiellen Wohlstands sich unsere Volkswirtschaften hinaufschrauben würden.
Nein, das glaube ich nicht. Vor 70 Jahren lebten viele Schweizer Familien noch in kleinen, meist schlecht isolierten Zweizimmerwohnungen oder gingen aufs Etagenklo. Kurzum: Es gab überall noch gewaltig „Luft nach oben“. Wohlstand in Form von mehr Platz, besserer Hygiene und Versorgung, Mobilität, wie wir ihn heute in weiten Teilen der Welt kennen, gab es schlicht nicht. Das Credo dieser Generation war nicht umsonst: „Unseren Kindern soll es mal besser gehen!“
Heute verspürt niemand mehr diesen Drang?
Nein.
Befragt man junge Menschen, was sie mal erreichen wollen, antworten sie oft: „Wenn ich es mal so gut habe wie die Eltern, bin ich zufrieden.“ Materieller Wohlstand ist nicht mehr ihr wichtigstes Problem.
Mathias Binswanger
Deshalb müssen vonseiten der Wirtschaft immer mehr neue Bedürfnisse aktiv geweckt werden, wenn die Wachstumsmaschine weiterlaufen soll.
Das ist ein Teil des Wachstumszwangs in der Wirtschaft. Haben Sie ein griffiges Beispiel, das die Auswüchse des „Wachsens um des Wachstums Willen“ illustriert?
Denken Sie etwa an „smarte“ Armbanduhren, die Sie überwachen. Warum sollte man sie als notwendig empfinden? Dass sie sich für viel Geld verkaufen lassen, liegt nicht an einem schon vorhandenen Bedürfnis. Vielmehr konnte man den Konsumenten über smarte Kampagnen weismachen, dass es sich damit gesünder und fitter leben lässt, und dass es sich lohnt, für die Information, wie viele Schritte sie heute noch gehen müssten, zu zahlen – erst mit Geld, dann mit Daten. (Lacht) Auch die immer kürzeren Verfallsdaten etwa von Mobilfunkgeräten kommen nicht zustande, weil ein älteres Gerät den Geist aufgibt oder zu langsam ist, sondern weil bessere Modelle auf den Markt kommen, die das Vorgängermodell entwerten, weil sie angeblich wichtige neue Funktionen besitzen und ein viel tolleres Design haben. Diese Konsumschleife ist für mich das wahre Wirtschaftswunder unserer Zeit: dass es so vielen Unternehmen gelingt, eigentlich gesättigten Konsumenten immer noch mehr Güter anzudrehen. Auf diese Weise, kann das Wachstum stets weitergehen, das für kapitalistische Wirtschaften systemnotwendig ist.
Konkreter?
Wirtschaftsunternehmen müssen zuvorderst eins: Gewinne machen. Sie tun das nicht, weil sie gierig sind, sondern weil sie sonst vom Markt verschwinden und damit auch die entsprechenden Arbeitsplätze verloren gehen. Um dauerhaft Gewinne zu erzielen, müssen sie stets neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, testen, auf den Markt bringen und absetzen können – sie müssen, kurz gesagt, kompetitiv bleiben. Gelingt ihnen das nicht, übernimmt irgendein Konkurrent ihr Marktsegment mit einem verbesserten oder billigeren Produkt, und ihr Unternehmen mitsamt der Belegschaft steht vor dem Aus. Solange die Wirtschaft wächst, kann eine Mehrheit der Unternehmen tatsächlich Gewinne machen. Hört das Wachstum jedoch auf, gerät die Wirtschaft schnell in eine Abwärtsspirale, da dann immer mehr Unternehmen Verluste machen, es zu Entlassungen kommt, die Nachfrage zurückgeht und deshalb weitere Unternehmen Probleme bekommen.
Besonders ausgeprägt, so schreiben Sie in Der Wachstumszwang, gilt das für Aktiengesellschaften.
Ja. Sind Sie eine AG, stehen Sie unter besonders starkem Wachstumsdruck. Wenn das Management eines solchen Unternehmens sagte „Wir verfolgen jetzt andere Ziele, und nehmen gewisse Gewinneinbußen dafür in Kauf“, so sinkt augenblicklich der Aktienkurs. Das ist dann die Chance für findige Investoren, solche Unternehmen aufzukaufen, das alte Management auszutauschen und die Firma wiederum auf neues Wachstum und die Maximierung des Shareholder Value zu trimmen – was wiederum neue Aktienkäufer anlockt. Danach können Sie das Unternehmen im Idealfall für viel Geld wiederverkaufen. Dieses Vorgehen ist sehr lukrativ. So lange dieser Druck da ist, kann man schlicht nicht erwarten, dass sich Unternehmen anders verhalten. Doch nicht nur Unternehmen, sondern auch der Staat hat Interesse an einem hohen Wachstum.
Inwiefern?
Nun, der Staat ist auf Wirtschaftswachstum angewiesen, weil er sich über die Besteuerung der arbeitenden Bevölkerung finanziert. Steigt die Arbeitslosenzahl, weil die Wirtschaft stagniert oder schrumpft, geht das zulasten der Sozialsysteme und wird schnell sehr teuer.
Im Umfeld des Staates entstehen heute jede Menge Jobs, die mit der „Organisation“ unseres immer komplexeren Wirtschaftssystems zu tun haben. Da wird keine Nachfrage direkt bedient, sondern es geht um Dinge wie Controlling, Evaluation oder Regulierung.
Mathias Binswanger
David Graeber nennt solche Jobs – allerdings auch im Hinblick auf die Privatwirtschaft – Bullshit Jobs.
Zum Beispiel?
Ein Beispiel ist der „Freischaffende Zertifizierungsauditor“. Na klar: Sobald eine Wirtschaft Zertifikate vorschreibt, muss sie jemand kontrollieren. Dieser Job dient nicht direkt der Produktion eines Gutes, sondern der Organisation des Systems. Auch hier wird eine Dienstleistung gegen Geld auf dem Markt verkauft, und somit leistet der Zertifizierungsauditor einen Beitrag zum BIP und generiert Einkommen. Auf diese Weise arbeiten immer weniger Menschen in der Produktion, und immer mehr Menschen in der Organisation der Wirtschaft. Die Produktion selbst braucht nämlich kaum noch Menschen, weil dort Roboter und Algorithmen am Werk sind. Die mit der Organisation verbundene Bürokratie sorgt weiterhin für Vollbeschäftigung, obwohl in der Produktion permanent Stellen verschwinden.
Damit haben wir die drei Ebenen des Wachstumszwangs angesprochen. Gesetzt den Fall, man folgt Ihrer Argumentation und wollte aus ihm ausbrechen: Wo müsste man ansetzen?
Auf Unternehmensebene.
Was also würden Sie einem Unternehmer, der weniger, dafür vielleicht qualitativ besser wachsen will, also raten?
Ich würde ihm sagen, dass die AG – zumindest die an der Börse gehandelte – ein bestimmtes Verhalten erzwingt. Eine Genossenschaft wäre oft die geeignetere Form. Ohne sie zu verherrlichen – denn auch sie leidet immer wieder unter Fehlanreizen – kann man sagen, dass sich bei Genossenschaften auch andere Zielsetzungen festschreiben lassen, die nicht mehr auf ein maximales, sondern ein gemäßigtes Wachstum abzielen. Es lohnte sich, die Idee der Genossenschaft weiterzuentwickeln, also hier mehr zu forschen und neue Rechtsformen zu entwickeln und zu testen, um die extremen Wachstumsanreize der AG aufzuheben.
Gibt es solche Forschungsbereiche bereits?
Kaum. Der hier erwähnte Zusammenhang wird noch kaum gesehen.
Selbst die größten Wachstumskritiker wollen sich nicht mit der Wachstumsdynamik und ihren Ursachen auseinandersetzen. Denn das stellt ihre „De-Growth“-Konzepte schnell wieder in Frage.
Mathias Binswanger
Wenn ich Sie richtig verstehe, stellt sich Wachstum für jene Teile der Welt, die noch nicht so gesättigt sind wie die unsrigen, weiterhin nicht als Problem, sondern als einzige Hoffnung dar. Ist es nicht etwas zynisch, Wachstum überhaupt pauschal zu kritisieren?
Deswegen kritisiere ich Wachstum nicht pauschal, sondern weise auf die Ambivalenz dieses Phänomens hin. Nur ein weiteres Wachstum der Weltwirtschaft ermöglicht es, den Wohlstand auch in anderen Regionen der Welt zu sichern, ohne dass wir in den hochentwickelten Ländern darauf verzichten müssen. Doch selbst bei uns ist es schwierig, vom Ziel eines maximalen Wachstums wegzukommen. Wenn beispielsweise China weiterhin rasant wächst und wir nicht, wird das schnell zum Argument dafür, dass wir uns jetzt auch wieder mehr anstrengen müssen. Andernfalls wird China im Vergleich zu uns relativ immer reicher und wir in Europa geraten zunehmend ins Hintertreffen. Die Arbeitslosigkeit würde zunehmen und die Investitionen gingen zurück. Das wollen wir aber unter allen Umständen vermeiden – und unter solchen Umständen ist es schwer, andere Ziele als Wirtschaftswachstum ernsthaft zu verfolgen.
Auf die Dauer steuern wir damit aber doch auf eine Art Equilibrium zu, nicht? Den einen wird es irgendwann nicht mehr nötig und sinnvoll erscheinen, noch schneller und noch stärker zu wachsen – und damit müssten die anderen auch nicht mehr in diesem Tempo schritthalten.
So weit in die Zukunft denken Ökonomen normalerweise nicht. (Lacht.) Sagen wir es aber so: In den nächsten Jahrzehnten wird das Wachstum der Weltwirtschaft wohl in ähnlichem Tempo weitergehen. Für Afrika wünschen sich das doch auch alle! Bis heute lässt sich für die Weltwirtschaft keine säkulare Stagnation beobachten. Die Wachstumsraten gehen nicht zurück, sondern sind über die Jahre hinweg sehr stabil
Wenn es gelingt, Wachstum durch technischen Fortschritt weiter vom Ressourcenverschleiß abzukoppeln, spricht doch wenig dagegen. Bisher ist es dem kapitalistischen System stets gelungen, die vermeintlichen Grenzen des Wachstums immer weiter zu verschieben – oder sogar zu überwinden.
Das ist ein interessanter Punkt. Denn seit es Wachstum gibt, gibt es Prognosen über sein Ende, und damit über das Ende des Kapitalismus. Zuerst hat man gedacht, die Nahrungsmittel reichten für so viele Menschen nicht aus, das war die plausible Theorie von Thomas Malthus. Heute können wir sagen: Das stimmt nicht. Historisch musste wahrscheinlich nie ein geringerer Prozentsatz der Menschen Hunger leiden als heute – obwohl wir so viele sind wie nie zuvor. Karl Marx meinte später, es käme zu weltweiter Verelendung, weil die Arbeiter von den Kapitalisten ausgebeutet werden und deshalb eine Revolution anzetteln. Doch auch er hat nicht Recht behalten, denn die Arbeiter partizipierten entgegen seiner Theorie auch massiv am Wohlstandszuwachs.
Zu Beginn der 1970er Jahre propagierte dann der „Club of Rome“ die natürlichen Grenzen des Wachstums, das Ende der Rohstoffe zum Antreiben der kapitalistischen Maschinerie.
Und auch diese Prognose hat sich bis heute nicht bewahrheitet. Die Ressourcen gingen uns nicht aus, im Gegenteil: Wir entdecken immer neue und immer größere Mengen der alten. Entsprechend sind die Preise, anders als prognostiziert, nie signifikant gestiegen. Die Grenzen sind weiterhin nicht direkt spürbar.
Und nun, im neuen Jahrtausend, sind die ausgemachten Grenzen des Wachstums die eines sich aufheizenden Klimas. Was ist diesmal anders?
Der Hauptgrund für das Nicht-Eintreten des Kollapses ist bei all diesen Vorhersagen der rasante technische Fortschritt gewesen, der Lösungen für das eine oder andere, durchaus auch größere Problem anbieten konnte: von enormen Effizienzsprüngen bei der Herstellung und globalen Distribution von Nahrungsmitteln über die Automatisierung ehemals anstrengender, körperlicher Arbeit bis hin zur aktuell tatsächlich fortschreitenden Entkoppelung von Öl und Gas durch das Anzapfen erneuerbarer Energien. Wachstum wird zwar nie völlig ohne Ressourcenverbrauch auskommen, aber eine Welt, die wächst und das Klima schont, ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Der Widerspruch zwischen endlicher Welt und unendlichem Wachstum taucht allerdings immer wieder auf!
Sie meinen: Weil unser System auf Wachstum ausgerichtet ist, ist es zuallererst darauf programmiert, einst ausgemachte Grenzen zu beseitigen, bevor Sie zum Problem werden – quasi aus „Eigeninteresse“?
Genau. Sobald neue Grenzen sich abzeichnen, intensivieren sich in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Anstrengungen, diese zu beseitigen. Denn nur so erschließt man neue Märkte, was ein ziemlich starker Anreiz zum Handeln, hier: zum passgenauen Entwickeln technischer Innovationen ist. Es ist also recht wahrscheinlich, dass sich die CO2-Emissionen verstärkt vom Wirtschaftswachstum entkoppeln werden. Aber das muss auf globaler Ebene erfolgen, wo ein absoluter Rückgang noch auf sich warten lässt.
Wie nützlich oder schädlich sind also Forderungen nach einem politisch auszuhandelnden, globalen Wachstumsziel? Man hört im Hinblick auf „vernünftige“ Wachstumsraten immer wieder die magischen „Zwei Prozent“.
Das richtige Maß hängt von den Umständen der jeweiligen Volkswirtschaften ab. Die Griechenland-Krise hat uns schmerzlich vor Augen geführt, was es bedeuten kann, wenn eine Wirtschaft sechs Jahre hintereinander – von 2008 bis 2013 – nicht wächst. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 30 Prozent und ein Drittel aller Unternehmen verschwand in diesem Zeitraum. Kapitalistische Wirtschaften sind auf Wachstum angewiesen, aber nicht auf maximales Wachstum. Wenn andere Ziele ein größeres politisches Gewicht erhalten, kann es durchaus sein, dass wir in Zukunft auf bestimmte, als schädlich erachtete Wachstumsoptionen verzichten.
Aber, und das ist die Abschlussfrage: ist das politisch überhaupt durchsetzbar?
Unmöglich, wie das die beinharten Wachstumsfreunde gerne behaupten, ist es jedenfalls nicht: Die Inflation haben wir genau auf diesem Wege zu bändigen gelernt. Die schmerzlich Erfahrungen mit ungebremstem Geldmengenwachstum waren so einschneidend, dass in der westlichen Geldpolitik irgendwann ein Konsens herrschte: Die Zentralbank darf das Wirtschaftswachstum bremsen, wenn die Inflation zu hoch zu werden droht. Diesen Gedanken kann man auch auf andere Bereiche übertragen!
Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Er ist unter anderem Autor des Buchs Sinnlose Wettbewerbe.
Nächste Schritte
Lesen Sie unser Feature zum Thema Klimawandel auf der englischen Seite des getAbstract-Journals: