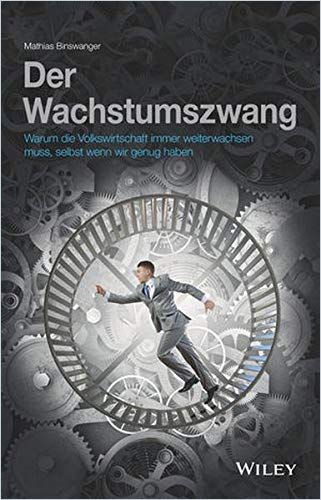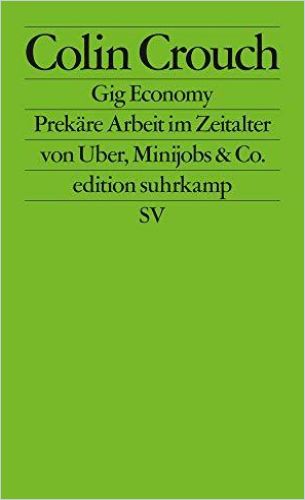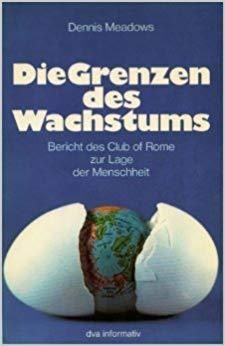Zwischen Wachstumszwang und Überlebensdrang

„I can‘t live, with or without you“, sang U2s Bono vor 33 Jahren – vermutlich über eine qualvolle Beziehung, aus der es kein Entrinnen gab. Ähnlich ist es mit dem Wirtschaftswachstum: Wir können einfach nicht ohne, wie der Schweizer Ökonom und Autor von Der Wachstumszwang, Mathias Binswanger, im Interview auf diesen Seiten schlüssig erklärte.
Wir können aber auch nicht mehr lange mit dieser Art von Wachstum leben. Hier scheidet sich mein Geist von dem Binswangers: Er hält es für wahrscheinlich, dass sich CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch langfristig vom Wirtschaftswachstum entkoppeln lassen. Ich halte das für einen Mythos. Warum mir der Glauben fehlt?
Da wäre zum einen die traurige Bilanz des „grünen Wachstums“ der vergangenen Jahrzehnte: Laut einer aktuellen BUND-Studie gibt es keinerlei Beweise dafür, dass eine Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch auf globaler Ebene jemals stattgefunden hätte. Rebound-Effekte – ein sparsames Auto wird häufiger gefahren – oder der Export umweltverschmutzender Industrien in Drittländer sind nur zwei von mehreren Gründen dafür: Nicht umsonst leuchten die hochgiftigen Gewässer rund um die Textilfabriken in Dhaka, Bangladesch, regelmäßig in den Trendfarben der Mailänder und Pariser Modesaison.
Zum anderen reicht mir ein Blick vor und hinter die eigene Haustür, um die Grenzen des freiwilligen, nachhaltigen Konsums abzustecken: Unsere 14-jährige Tochter weigert sich seit einiger Zeit, in Plastik verpackte Lebensmittel oder Kosmetikprodukte zu benutzen. Unterwäsche und Socken dürfen nur noch 100 Prozent bio und fair produziert sein, und beim nächsten Handy – ihr jetziges pfeift auf dem letzten Loch – geht unter einem Fairphone gar nichts. Und obwohl sie größere Anschaffungen zur Hälfte selbst bezahlen muss, ändert das nichts an den nackten Tatsachen:
Nachhaltig produzierte und verpackte Produkte kosten das Zwei-, Drei- bis Zehnfache (wie z.B. besagte Unterwäsche).
Das sprengt unsere Familienkasse – da wir als Freelancer in der finanziell wenig nachhaltigen Gig-Economy arbeiten, sind ihre Konsumwünsche rasch an natürliche Wachstumsgrenzen gestoßen. Außerdem bleibt ihr verzweifelter Aktivismus ein Tropfen auf dem heißen Stein: 60 neue Kleidungsstücke hängt sich der Durchschnittsdeutsche pro Jahr in den Schrank – trägt diese aber nur noch halb so lange wie vor 15 Jahren. Klar, es gibt jede Menge innovative Konzepte zum Kleidertausch oder -verleih. Doch die fristen ein kleines, feines Nischendasein. Der Trend zur Fast Fashion bleibt ungebrochen. Er ist die unvermeidliche Schattenseite dessen, was Binswanger als systemnotwendiges Wachstum bezeichnet: „Diese Konsumschleife ist für mich das wahre Wirtschaftswunder unserer Zeit: dass es so vielen Unternehmen gelingt, eigentlich gesättigten Konsumenten immer noch mehr Güter anzudrehen.“
Ich sehe nicht, wie sich diese Konsumschleife für bald 8 Milliarden Menschen nachhaltig weiterdrehen ließe. Eine erdrückende Mehrheit kann oder will sich nachhaltigen Konsum nicht leisten – und die verbleibende Minderheit in den Wohlstandsgesellschaften wird nie die notwendige kritische Masse erreichen. Dennis Meadows, Autor von Die Grenzen des Wachstums, kam 1972 zu dem banalen Schluss, dass grenzenloses Wachstum auf einem endlichen Planeten unmöglich ist. Heute wird er zu Unrecht als falscher Untergangsprophet belächelt: In Wahrheit hat er nie behauptet, dass uns am Tag X die Ressourcen ausgehen, sondern dass vielmehr die Umwelt dem Energie- und Rohstoffverbrauch zwangsläufig Grenzen setzt. Und diesen Punkt haben wir bereits überschritten.
Mathias Binswanger argumentiert dagegen, dass wir immer neue und größere Mengen an Rohstoffen entdecken und die Preise deshalb, anders als von Meadows prognostiziert, nie signifikant gestiegen seien: „Die Grenzen sind weiterhin nicht direkt spürbar.“ Das stimmt. Allerdings nur solange, wie die Umweltfolgekosten nicht eingepreist werden. Denn hier liegt der eigentliche, marktverzerrende Fehler im System: Solange Preise nicht „die Wahrheit sagen“, wie Maja Göpel vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WGBU) es nennt, ist der Hinweis auf vermeintlich flexible Wachstumsgrenzen Augenwischerei. Die Gülle in der Viehzucht, der CO2-Ausstoß in der Fossilwirtschaft, die Folgen der intensiven Landwirtschaft für die Artenvielfalt – all das verursacht Grenzkosten in Billionenhöhe, die niemand bezahlt. Die „Öko-Dienstleistungen“ der Natur sind gratis.
Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) müssten aber beispielsweise ein Steak das Fünffache und Kartoffeln das Doppelte kosten, um dafür aufzukommen. Von der Kik-Unterwäsche erst gar nicht zu reden.
Radikal zu Ende gedacht könnte dieses Einpreisen ein jähes Ende der Massentierhaltung, Fossilindustrie und Fast Fashion bedeuten. Wahrscheinlich hätte es auch massive wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwerfungen zur Folge. Wohlstand würde in großem Stil vernichtet, umverteilt und woanders neu entstehen. Und ja, auch Verzicht wäre ein Teil dieser Rechnung: Jeden Tag haufenweise Fleisch essen? Unbezahlbar. 60 neue Klamotten im Jahr? Vor 40 Jahren waren es noch zwölf. Wenn die Wirtschaft unter der Maßgabe ehrlicher Preise, fairer Löhne und qualitativen Konsums weiterwächst, umso besser. Wenn nicht, müssen wir halt damit leben.