Nicht so schnell, sagt Francis Fukuyama, selbst ein Endzeitprophet mit durchwachsener Erfolgsbilanz. Statt den Liberalismus abzuschreiben, schlägt er vor, zu den Anfängen der freiheitlichen Philosophie zurückzukehren.
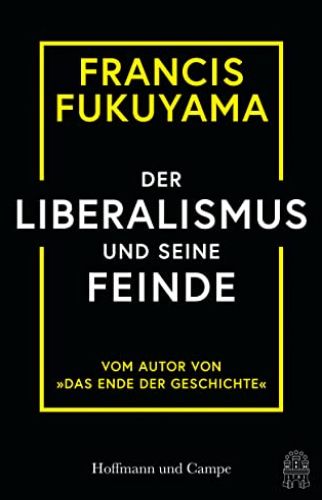
Ist der Liberalismus am Ende?
Die Feinde im Innern
Mit seiner 1989 veröffentlichten These vom Ende der Geschichte ist Francis Fukuyama gescheitert. Das Modell der westlichen liberalen Demokratie hat sich nicht durchgesetzt. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung gab es Anfang 2022 erstmals seit 2004 weltweit mehr Autokratien als Demokratien. Fukuyama hat seinen Irrtum wiederholt eingestanden. Heute sieht er die Gesellschaften des Westens nicht nur durch Putin, Erdogan, Orban & Co. gefährdet, sondern vor allem durch illiberale Strömungen – rechte wie linke – im Innern. Dieser Bedrohung widmet er sein jüngstes Buch.
Ideal und Wirklichkeit
Fukuyama definiert den klassischen Liberalismus als Staatsform, die individuelle Rechte schützt und durchsetzt. Diese Rechte sind egalitär und universalistisch zugleich, das heißt, sie gelten für alle Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Ethnie, Kultur oder Religion. Der Liberalismus garantiert das Recht auf Eigentum, fördert Toleranz und Gewaltfreiheit und ermöglicht Wirtschaftswachstum, wissenschaftlichen Fortschritt und ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben.
Jeder Mensch will seine Lebensziele selbst bestimmen: womit er seinen Lebensunterhalt erarbeitet, wen er heiratet, wo er leben will, mit wem er sich verbindet, mit wem er handelt, wie und worüber er seine Meinung äußert und woran er glaubt. Francis Fukuyama
So weit die Theorie. In der Praxis wurde der Liberalismus immer wieder der Inkonsequenz und Scheinheiligkeit überführt. Beispielsweise blieb das Recht auf freie Selbstbestimmung lange auf eine kleine Gruppe wohlhabender, weißer Männer beschränkt. Doch für Fukuyama liegt die Kraft der liberalen Idee in ihrem Potenzial zur stetigen Verbesserung. In den westlichen Gesellschaften des ausklingenden 20. Jahrhunderts sieht er einen (Beinahe-)Idealzustand erreicht: Demnach garantieren demokratisch regierte Wohlfahrtsstaaten den Wettbewerb, federn Ungleichheiten ab und bescheren ihren Bevölkerungen ein besseres Leben als jemals zuvor.
Die neoliberale Revolution frisst ihre Kinder
Seit der Jahrtausendwende hat dieses Ideal an Strahlkraft verloren. Der Autor macht dafür sowohl die marktradikale Rechte als auch eine wieder erstarkte progressive Linke verantwortlich. Indem beide Seiten die liberalen Prinzipien von Autonomie und Selbstbestimmung auf die Spitze trieben, untergruben sie laut Fukuyama das Fundament der liberalen Gesellschaft.
Für den Autor ist die vor 40 Jahren ausgerufene neoliberale Revolution über ihre berechtigten Ziele hinausgeschossen. Zwar hätten sich viele westliche Volkswirtschaften Ende der 1970er-Jahre als ineffizient und überreguliert herausgestellt. Doch es brauche einen durchsetzungsstarken Staat, der öffentliche Güter zur Verfügung stellt, exzessiven Reichtum umverteilt und die Verlierer der Globalisierung auffängt.
Ein Großteil der neoliberalen Feindseligkeit gegenüber dem Staat ist schlicht irrational.Francis Fukuyama
Der Politikwissenschaftler führt die Theorie vom Primat der wirtschaftlichen Effizienz ad absurdum: Angenommen, Starbucks könnte billigeren und besseren Kaffee anbieten als französische Cafébesitzer. Wären wir wirklich besser dran, wenn die US-Kaffeehauskette Tausende unabhängiger Cafés in Frankreich vom Markt verdrängen würde?
Identitätspolitische Irrwege
Während die neoliberalen Exzesse Rechtspopulisten wie Donald Trump den Weg ebneten, schlug der linke Liberalismus in eine moderne Identitätspolitik um, die versucht, die Rechte von Gruppen über die Rechte von Individuen zu stellen. Auch dieser Irrweg hat seinen Ursprung in einem liberalen Projekt: der Aufwertung der persönlichen Autonomie und damit der Befreiung des Individuums von gesellschaftlichen, familiären oder religiösen Zwängen aller Art. Der übersteigerte Wunsch nach Selbstverwirklichung bringt laut Fukuyama jedoch zwei Probleme mit sich. Erstens untergräbt er das Gemeinschaftsgefühl, ohne das kein liberales Gemeinwesen überleben kann. Und zweitens stoßen immer mehr Menschen bei ihrer Suche auf eine so große innere Leere, dass sie sich einer Gruppenidentität zuwenden.
Die Identitätspolitik versucht, das liberale Projekt zu vollenden und eine Gesellschaft zu schaffen, die, so die Hoffnung, ‚farbenblind‘ sein wird. Francis Fukuyama
Fukuyama hält zwar den Versuch marginalisierter Gruppen, das Versprechen des Liberalismus einzulösen, für legitim. Doch inzwischen hätten sie den Bogen überspannt. Die moderne Identitätspolitik führt seiner Ansicht nach zu zermürbenden Kulturkämpfen, moralischem Relativismus und irrationaler Fortschrittsfeindlichkeit. Zu allem Überfluss machen ihre Vertreter liberale Politik und Werte für sämtliche Übel der Welt verantwortlich – vom Kolonialismus und Faschismus über Sexismus und Rassismus bis hin zum Klimawandel und zum Hass gegen Homosexuelle. In Wahrheit, so der Autor, schütze keine Staatsform die Rechte diverser Gruppen so zuverlässig wie die liberale Demokratie. Sowohl die populistische Rechte als auch die progressive Linke tue sich aber schwer damit, andere Überzeugungen als die eigenen und damit echte Vielfalt zu akzeptieren.
Absage an progressive Bewegungen
Fukuyama will beide Lager nicht gleichsetzen. Die Bedrohung von rechts sei unmittelbar und politisch, die von links kulturell und sie wirke langsamer. Georg Simmerl von der Süddeutschen Zeitung überzeugt er damit nicht. Die Darstellung der vermeintlich illiberalen progressiven Linken und ihrer Vordenker hält der Rezensent für tendenziös. Außerdem bemängelt er, dass Fukuyama sich nicht von den rechten Polemiken über die „Cancel Culture“ distanziere, sondern sich diese zu eigen mache. Überhaupt bleibt die Darstellung progressiver gesellschaftlicher Bewegungen im Buch oft eindimensional. Ein Beispiel ist die unter dem Slogan „Defund the Police“ geforderte Reform der US-Polizeibehörden. Fukuyama verschweigt, dass es dabei eben nicht darum geht, der Polizei alle staatlichen Mittel zu entziehen, sondern darum, einen Teil der Ressourcen in Sozialarbeit, Gesundheitsfürsorge und den Kampf gegen die Armut umzuschichten.
Unklar bleibt auch, wie er mit dem Vorschlag einer liberalökonomischen Mäßigung die ökologischen Zwillingskrisen der Gegenwart – Klimawandel und Artensterben – in den Griff bekommen möchte. Als „nachgerade schlafwandlerisch“ bezeichnet Christoph Möllers von der FAZ schließlich das Desinteresse des Autors an Versuchen, die klassische liberale Theorie weiterzuentwickeln. Möllers Fazit: „Nur mit Fukuyama gewappnet, dürfte das Ende des Liberalismus dem Ende der Geschichte zuvorkommen.“
Lesenswert ist das Buch trotzdem. Denn es fordert dazu auf, aus abgestandenen Meinungsblasen auszubrechen, Brücken ins Feindeslager zu schlagen und sich zumindest auf den kleinsten fukuyamischen Nenner zu einigen: Der Liberalismus ist die schlechteste aller Staatsformen – ausgenommen alle anderen.







