Der technologische Wandel der Digitalisierung geht so schnell, dass wir kaum begreifen, was mit unseren Daten passiert und wohin die Reise geht. Mit philosophischen Mitteln trennt Luciano Floridi gewünschte von unerwünschten Entwicklungen und wirft einen ambivalenten Blick in die Zukunft.
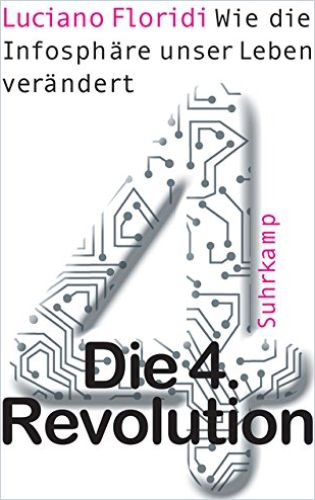
Der neue Mensch entsteht im Netz
Die Digitalisierung ist ein technologischer Vorgang – aber auch viel mehr als das. Das zeigt sich bei immer mehr gesellschaftlich relevanten Themen, sei es im Beruf, bei Wahlen, beim Einkaufen, in der Schule oder bei der Partnersuche. Wie sehr die rasante Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien unser Leben bereits verändert hat und weiter verändert, erklärt Luciano Floridi. Der Philosoph von der Universität Oxford streift dabei viele Lebensbereiche und wagt Blicke in die Zukunft.
Es entsteht ein ambivalentes Szenario, das Raum für optimistische Interpretationen ebenso wie für pessimistische Aussichten lässt. Der Autor beschreibt die technologischen Trends weder glorifizierend noch alarmistisch. Für ihn gibt es etwa bei künstlicher Intelligenz nicht die pauschale Wahl zwischen menschlicher Macht oder Ohnmacht. Er erkennt vielmehr die vielen Wahlmöglichkeiten, vor denen die Menschheit und jeder Einzelne heute stehen. Unterm Strich sieht er digitale Technologien als großen Gewinn, als Fortschritt im Sinne einer Revolution. Nach seiner Zählung ist die entstehende „Infosphäre“, die von intelligenten Menschen und vernunftbegabten Maschinen bevölkert wird, die vierte wissenschaftliche Revolution seit Kopernikus, Darwin und Freud. Als ersten Vertreter der neuen, digitalen Welle der Veränderung nennt er den britischen Computerpionier Alan Turing, mit dem er sich viel befasst hat. Ihn verortet Floridi am Beginn des Zeitalters der Informations- und Kommunikationstechnologien.
Information ist zur Grundressource der Wirtschaft geworden
Wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist, demonstriert Floridi zunächst durch den Blick auf die Technik. Informationsverarbeitung ist heute so viel billiger als früher. Die Zahl der vernetzten Geräte steigt schneller als die Weltbevölkerung. Maschinen kommunizieren zunehmend untereinander. Weltweit entstehen inzwischen mehr digitale Daten, als gespeichert werden können. Meist überschreiben neue Daten die alten. Die verbreitete Ansicht, dass alles Digitale für die Ewigkeit gespeichert werde, das Internet also nichts vergesse, ist somit ein Mythos, nach Ansicht des Philosophen. Er berät übrigens den Google-Konzern in der Frage des Rechts auf Vergessenwerden.
Noch spannender als die technologische Seite des Fortschritts ist für Floridi die Art und Weise, wie sich die Menschen und ihre Gesellschaft verändern. Information erklärt er zur Grundressource unserer Zeit. Deutschlands Wohlstand basiere bereits zu mindestens 70 Prozent auf immateriellen Gütern. Wie geht die Wirtschaft damit um, dass mehr und mehr analoge Güter (etwa Musik-CDs) digital geworden sind (MP3-Dateien)? Was macht es mit uns, wenn wir über Schnittstellen mit Maschinen verbunden sind – ohne zu wissen, dass es die Schnittstellen überhaupt gibt oder wie viele Prozesse im Hintergrund laufen? Smarte Kühlschränke, Wäsche mit Mikrochips, Brillen mit Displays: Wo Alltagsgegenstände interaktiv werden, verfließt für den Autor die Grenze zwischen Offline- und Onlinewelt, bis das Leben „onlife“ und der Mensch zum „Inforg“ wird – zu einem vernetzten informationellen Organismus.
Das virtuelle Selbst liegt der Generation Z am Herzen
Der Autor hält die Generation Z bereits für derart transformationsbereite Wesen. Die medienaffinen, nach 2001 geborenen Zeitgenossen, von denen viele ihre Beziehungen per Handy anbahnen und beenden, sind für ihn die Vorreiter eines Wandels, der die gesamte Gesellschaft erfassen wird. Nie zuvor hätten sich so viele Menschen mit ihrer medialen Selbstdarstellung befasst wie heute. Das soziale Selbst, das dabei entsteht, wirke zurück auf die Identität und das Selbstbild des Nutzers. Kritiker sprechen von einem Zeitalter des Narzissmus und des Künstlichen. Die Pessimisten liegen aber nicht richtig, sagt der italienische Philosoph. Für ihn sind Landschaften im Onlinespiel auch nicht unnatürlicher als Pflanzen im Kleingarten, beide seien nämlich menschengemacht. Im neuen, digitalen Umfeld sieht er die Chance, die eigene Identität freier gestalten zu können als vorher. Unser virtuelles Selbst entwickle sich anders als wir: Während wir altern, könne es lediglich veralten.
Der digitale Egotrip liefert ein gutes Beispiel für die Ambivalenz, mit der Floridi in die Zukunft blickt. Was die einen freut, ist für andere eine Horrorvorstellung. Wer mit seinen Freunden über ein soziales Medium vernetzt sei, müsse sich rechtfertigen, wenn er nicht rasch auf sie reagiere, hat er festgestellt. Die Gesellschaft werde sich demnach spalten: in jene, die im Fluss der Informationen stehen, und jene, die abgekoppelt sind. „Digital Divide“ ist nicht die einzige Schattenseite, die der Autor thematisiert. Wenn etwa Google mit Profilen seiner Nutzer handle, liefen diese Gefahr, entindividualisiert zu werden. Wir sollten uns dem Autor zufolge also nicht völlig an die Logik der Digitalwelt anpassen: Schlimmstenfalls bauen wir sonst nur noch runde Wohnungen, damit Staubsaugroboter effektiv ihren Dienst verrichten können.
Staaten verlieren in der „Infosphäre“ an Macht
Das Buch teilt den Makel anderer Zukunftsprognosen. So offen viele Fragen und so vage die Folgen vieler Trends noch sind, so schwammig bleibt auch das Bild von der Zukunft. Der Reiz besteht für den Autor aber nicht darin, möglichst genaue Vorhersagen zu liefern, sondern das Augenmerk auf die Gestaltbarkeit unserer Zukunft zu lenken. Seine Tipps, sich individuell passend in der neuen Welt einzurichten, wecken allerdings Zweifel an der Umsetzbarkeit. Beispielsweise scheinen der Schutz der informationellen Privatsphäre oder der digitalen Identität im Netz illusorisch in einem Umfeld, in dem Anonymität viel weniger gegeben ist, als viele denken.
Ob seine Lösungsvorschläge – Selbstkontrolle, Gesetze und smarte Sicherheitsanwendungen wie biometrische Verfahren – dem Problem des Datenmissbrauchs gerecht werden können, bleibt offen. Ebenso fraglich ist, wie eine grüne Transformation der stromfressenden Infosphäre in ein umweltverträgliches Biotop gelingen soll. Zumal Staaten laut Prognose des Autors als Akteure an Bedeutung verlieren werden. Die Gestaltungsmacht der Regierungen nehme zukünftig ab statt zu. Der soziale und der politische Raum seien nicht mehr deckungsgleich, wenn sich die Menschen mehr und mehr in der staatenlosen Infosphäre tummelten. Indem der Staat sich zur Informationsgesellschaft wandle, entmachte er sich also selbst, befindet der Philosoph.
Trotz allem sieht er in Gesetzen eine „Metatechnologie“, mit der sich neue Technologien in die richtigen Bahnen lenken lassen. So sehr dies überrascht, so nachvollziehbar scheint im Gegenzug die wichtige Rolle, die der Autor Konzernen wie Google oder Facebook zuschreibt. Diese müssten künftig weltweit hohe Erwartungen an Bildung und Wissenschaft mit Leben füllen.












